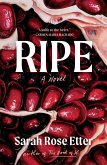In 'Die Großwäscherei', dem ersten Roman von Andor Endre Gelléri, dampfen die Waschbottiche, rotieren die Waschmaschinen und Wäscheschleudern, gleiten die Bügeleisen über die Seidenhemden, pfeifen die Beheizungsrohre. Es ist der pulsierende Rhythmus der belebten Straßen und der niemals ruhenden Maschinen - der modernen Großstadt Budapest.In der Wäscherei arbeiten Waschfrauen und Heizer, Färbejungen und Bügelmädchen, Vorarbeiter und Hausierer, die alle von einem besseren Leben träumen. Doch vorerst fügen sie sich in den Arbeitsablauf in der Wäscherei, um ihre Existenz zu sichern. Die Wäscherei ist wie ein vielstimmiger Bienenstock, mit dem Besitzer Jeno Taube als Herrscher. Taube ist besessen von seinem Ideal von Sauberkeit, doch er ist auch gelangweilt von seiner Macht und sucht Zerstreuung. Alle schwirren um ihn herum, um etwas von seiner Gunst abzubekommen.Gelléri formt das Treiben in der Wäscherei zu einem sprachlichen Erlebnis. Mit kräftigen Farben malt er die Visionen und die Ängste der Menschen aus und lässt den Leser das Schicksal der einzelnen Figuren mit allen Sinnen erleben. Man meint die Gerüche der Wäscherei zu riechen, die diesigen Dampfschwaden zu spüren, die leuchtenden Kleider zu sehen und die ratternd stampfenden Maschinen der Wäscherei zu hören. 'Die Großwäscherei' ist ein schillernder Glanzpunkt der ungarischen Literatur und in der Beschreibung der Arbeitswelt mit ihren Zumutungen und Erfordernissen heute noch genauso aktuell wie damals.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Judith Leister findet Gefallen an Andor Endre Gelleris Geschichte aus der Budapester Großwäscherei Phönix. Die Wäscherei als stampfende, dampfende Menschmaschine im Ungarn der dreißiger Jahre scheint ihr gut geeignet als Kulisse für eine ideologiefreie Kritik an frühkapitalistischen Zuständen und für ein proletarisches Panorama des Budapester Handels und Wandels. Wie der negative Machoheld des sinnlichen und zeitlosen Romans, der Großwäschereibesitzer Jenö Taube, seine Lebenskrise meistert, hat Leister gern gelesen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Den Dreck, der ihn reich gemacht hat, will er loswerden: Andor Endre Gelléris grandioser Kurzroman "Die Großwäscherei" zeigt Budapest in den dreißiger Jahren und weckt Erinnerungen an Zola.
Wieder eine Klassikerneuentdeckung, wieder eine literarische Jahrhundertausnahme und wieder ein kleiner, in diesem Fall klitzekleiner Verlag, der Großes vollbringt: "Die Großwäscherei" heißt der einzige Kurzroman des Ungarn Andor Endre Gelléri, der 1906 als Sohn eines jüdischen Geldschrankbauers in Budapest geboren wurde und nur wenige Tage nach der Befreiung des Lagers in Mauthausen, wo er inhaftiert war, im Mai 1945 am Flecktyphus starb. An die achtzig Novellen sowie ein autobiographisches Romanfragment - entstanden in den Arbeitslagern der ungarischen Nazis - hat Gelléri hinterlassen. Sándor Márai und Dezso Kosztolányi gehörten zu seinen Förderern. Nun hat der Guggolz Verlag eine Neuübersetzung des Romans publiziert, in dem Form und Inhalt zu einem phänomenalen Akkord verschmelzen.
Wir befinden uns in einem alten Budapester Arbeiterviertel. Galizische Juden in Kaftanen gehen ihren mühsamen Beschäftigungen nach. Mehlsäcke werden herumgetragen, und aus der Dampfwäscherei Phönix, einem fünfräumigen Großbetrieb, in dem an die hundert Menschen zwischen kochenden Kesseln und im beißenden Geruch der Chemikalien arbeiten, dringen Dunstschwaden ans Tageslicht. "Das zur Straße hin gelegene Geschäft des Phönix ist winzig; die Kundschaft und die Angestellten stolpern übereinander, von der Straße dringt ohrenbetäubender Lärm herein, von drinnen dröhnt das Grollen der Maschinen hinter der Holzschwingtür hervor. Wenn diese Tür sich quietschend öffnet, ist ein Saal mit sauberer Weißwäsche zu sehen, in dem die Büglerinnen arbeiten. Von hier aus kommt man in die düstere Wäschemarkierkammer: Wie ein Mond brennt hier stets die große Lampe, darunter sitzt mit gebeugtem Rücken ein Markiermädchen und schreibt mit einem Stift die seltsamsten Zeichen auf die unzähligen Kragen, die Tausende von Hemden, die zuweilen abstoßend dreckige Unterwäsche." Ein paar Räume weiter steht ein Heizer "vor dem rot flackernden Feuer im Kessel", rußbeschmiert und "mit den mageren Gliedmaßen wie ein Verdammter". Eine Hölle, kein Zweifel.
Gelléri, der sich immer wieder mit den Lebensumständen des Proletariats beschäftigt hat, schildert einen Maschinenkosmos, bevölkert von kleinen und großen Erfüllungsgehilfen des Teufels. In ihm wird gekocht, gefärbt, gestärkt und planiert, als gelte es, die Welt wie einen Phönix aus der Asche neu zu erschaffen. Sein fiebrig-bildreicher Duktus erinnert mehr an expressionistische Großstadtlyrik als an den "feenhaften Realismus", den Gelléri einst vom älteren Kosztolányi als Etikett angeheftet bekam. Und wer ist der leitende Teufel dieser dampfenden Hölle? Ein Mann namens Taube, ein deutscher Jude, ein lasterhafter Zeitgenosse, der Menschen ein Leben lang benutzt und gedemütigt hat, der sich rühmt, mit jeder seiner Wäscherinnen im Bett gewesen zu sein, und der im Laufe des Romans auf einmal von seltsamen Reinigungsphantasien heimgesucht wird.
Seifendampf, Chlor, Ammoniak-Soda, Salmiak - so heißen die Substanzen, mit denen nicht nur Färberjungen und Waschgehilfen umzugehen verstehen, aus diesen Chemikalien scheint auch Gelléris Roman seine Färbung zu beziehen. Denn auch Taube veranstaltet giftige Experimente mit seinen Angestellten. Er lässt einen unglücklichen Betriebsleiter feuern und infiziert damit den unterdrückten Machtinstinkt eines anderen, stachelt diesen auf zu haarsträubender Niedertracht. Fortan steht dieser Novák ("Du hast mindestens zehn Geliebte, zu jeder ein Paar Lackschuhe, bist der Herr Betriebsleiter") in der Waschhalle herum, saugt an einer Zigarettenspitze und malträtiert seine Untergebenen. Das Ganze erinnert an die Schilderungen des Kumpelmilieus in Zolas "Germinal". Mit gleicher Drastik wird das Leben des Idealisten Tir geschildert, der in einem Kellerverlies lebt und dennoch den Verschmutzungsgelegenheiten der Seele trotzt, indem er Reis in die Schälchen der Arbeiterinnen schmuggelt - "mit nicht gerade reinen Händen, dafür reinen Herzens".
Auch begleiten wir die füllige Prostituierte Ilcsi, die seit Wochen verängstigt durch die Straßen der Hauptstadt irrt. "Ihr rundes Gesicht war eingefallen, und ihr weißer Teint war wie vom Gelb der Galle gefärbt. Ihrem Dromedarkörper war zwar keine Gewichtsabnahme anzusehen, ihre Gestalt wurde jedoch von einer schattenartigen Schwäche umweht, und von ihren dicken Lippen tönten Klagelaute in die Nebelluft. Sie hatte eine stecknadelkopfgroße bräunliche Warze mitten zwischen den Augenbrauen, die, obwohl sie so klein war, jedem ins Auge zu springen schien. Dieses warzenartige Etwas wucherte, juckte und schmerzte."
Fieberphantasien verfolgen den alten Fabrikbesitzer. Wer hat ihn je geliebt, fragt er sich, die roten Haare inzwischen von reichlich grauen Fäden durchwirkt. Überhaupt entfaltet die Farbensymbolik dieses Romans eine ganz eigene Poetik. Da liest man von gelb verfärbten Servietten, die unter Benutzung der falschen Chemikalie grünfleckig werden und unter rot glühendem Feuer einer Schwefelsäurebehandlung unterzogen werden müssen, die alles noch schlimmer macht und den Färber fast sein Leben kostet. Und schließlich schneit es: weiß und rein, die Stadt liegt da "wie das seidene Fell einer schlafenden Angorakatze", so beruhigend wie ein frisch gewalkter Stapel Wäsche. Von kryptoreligiösen Reinheitsritualen, auch von sozialen Reinigungsphantasien, die das heraufziehende politische Zeitalter nur andeuten, nicht bedeuten, handelt dieser formbewusste Roman, der jetzt in der schönen Übersetzung von Timea Tankó zu entdecken ist.
KATHARINA TEUTSCH
Andor Endre Gelléri: "Die Großwäscherei". Roman.
Aus dem Ungarischen von Timea Tankó. Guggolz Verlag, Berlin 2015. 221 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main