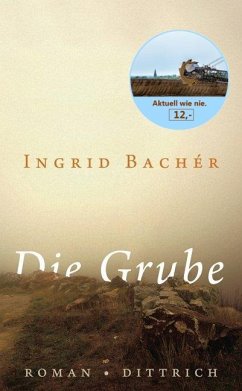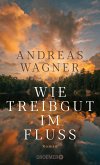Eine Frau bekommt 2010 die Nachricht, dass ihr verschwundener Bruder Simon für tot erklärt werden soll. Sie aber weiß, wie er starb. Damals 1992 in Garzweiler, einem Ort, der auf keiner Landkarte mehr existiert. Sie ist allein mit dieser Nachricht in Borschemich. Auch dies ein altes Dorf, das bald wie Garzweiler von der Grube geschluckt werden wird. In dieser Grube, jetzt schon eine der größten künstlich hergestellten Öffnungen der Erde, wird Braunkohle im Tagebaubetrieb abgebaut. Um über Simons Ende zu sprechen, versucht sie Kerstin, Simons Frau, zu erreichen und Simons Sohn, der sein Erbe sein wird.Die Erzählerin berichtet vom Aschoffschen Hof, von der Familie und von Simon, ihrem geliebten und bewunderten Bruder. Er konnte die Zerstörung seines Hofes und des Landes nicht verhindern. Er setzte sich aber vehement dafür ein, dass man der Grube nicht noch weiteres Land opfert, und mit ihm wieder viele Dörfer, Wälder und Felder, Häuser und Höfe, Kirchen und Friedhöfe. Unausweichlich die Auseinandersetzung zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Stromkonzerns, den Interessen der Politiker und der Bürger. Ingrid Bachérs Roman ist der Versuch, das Ungeheuerliche auch durch Sprache zu verstehen. Es geht um Heimatverlust, um die Beschreibung einer Region, die auf der Landkarte zu einem blinden Fleck geworden ist. Der blinde Fleck ist kein unerforschtes Gebiet, es geht um den Raub der Erinnerungen und der Geschichte.Ingrid Bachérs Sprache ist genau und poetisch. 'Jeder Mensch habe das Recht, nicht vergessen zu werden. Eine von so vielen Formulierungen, die den Leser berühren - wie jene vom 'ausgeweideten Land', das gereinigt wurde von allen Lebensspuren', schreibt Lothar Schröder in der Rheinischen Post.

Ambivalenz der Moderne: Ingrid Bachér erzählt die Geschichte des niederrheinischen Heimatverlustes durch den Braunkohletagebau mit Empathie und Suggestionskraft.
Das Feld ist mit wild blühender Kamille bedeckt. Am Rand öffnet sich eine gewaltige Grube. Von der Abbruchkante aus kann man nur schwach die gegenüberliegende Seite erkennen, so unübersehbar weit erstrecken sich die Terrassen, auf denen die Schaufelradbagger arbeiten, um das Land auszuhöhlen. Der Lössboden wird abtransportiert, gelbe und kalkweiße Schichten werden von Loren davongefahren, bevor in der Tiefe die Braunkohle zum Vorschein kommt. 1983 entstand durch den Zusammenschluss von zwei älteren Abbaufeldern der Großtagebau Garzweiler, für den es bereit Ende der achtziger Jahre Erweiterungspläne gab: "Garzweiler II". Ingrid Bachérs Roman rückt das Schlagwort von damals wieder in die Mitte des Bewusstseins und erzählt von den Folgen des Tagebaus für die Menschen im rheinischen Braunkohlerevier, vom erbitterten Widerstand ganzer Ortschaften gegen ihre Umsiedlung, vom Zusammenstoß einer traditionsbehüteten Welt mit einer gefräßigen Moderne.
Der Roman setzt im Jahr 2010 ein. Eine alternde Erzählerin bewohnt ein Haus, das der expandierenden Grube weichen soll, und sie erinnert sich, wie schmerzhaft sie dies schon einmal erlebte. Gemeinsam mit ihrem Bruder, dessen Leben und Sterben in der Erinnerung eng mit der Geschichte der Region verbunden wird, wehrte sie sich über Jahre gegen die Aufgabe des Familienbesitzes, eines Vierkanthofs am Rande von Garzweiler mit der Jahreszahl 1794 über dem Torbogen. Ingrid Bachér lässt noch einmal die Schätzer durchs Dorf gehen, die den Wert der Häuser bestimmten, bevor die meisten Bewohner in ein Neubaugebiet umsiedelten und ein Gebäude nach dem anderen vom Erdboden verschwand. Diejenigen, die auf dem zunehmend leeren Land ausharrten, sahen eines Tages die Abrissbirne gegen die Kirchenmauern schlagen und einen kleinen Bagger die Erde des Friedhofs öffnen. Zerfallende Särge wurden hervorgeholt, Knochen eingesammelt und in weißen Kisten davongefahren.
"Ja - zur Heimat! Nein - zu Rheinbraun". Diese Protestschilder hingen in vielen der inzwischen abgebaggerten Ortschaften. In einer Vorbemerkung zu ihrem Roman betont die einundachtzigjährige ehemalige Präsidentin des westdeutschen P.E.N.-Zentrums, dass ihrer fiktionalen Schilderung eine lange und aktive Begleitung des Konflikts vorausging. Und so beschreibt Ingrid Bachér die Geschichte des niederrheinischen Heimatverlustes mit Empathie und Suggestionskraft, wenngleich sie auch Fakten zur Geschichte des Braunkohletagebaus in der Region, zu Klima- und Grundwasserproblemen und den zähen Auseinandersetzungen kirchlicher Verbände, Naturschützer und Bürgerinitiativen mit Politik und Industrie liefert. Das Treffen der Tagebaugegner 1989 in Erkelenz wird zum emotionalen Höhepunkt des Protests, auf dem die Kritiker dem verantwortlichen Minister ihre Argumente vortragen und sich den wirtschaftlichen Interessen der Betreiber verweigern.
Der Konzern wird im Roman "die Krake" genannt und zum Symbol einer zerstörerischen Moderne stilisiert. Gegen diese wendet der Text sich eigentlich. Die Moderne ist technisch hoch gerüstet und scheinbar rational, tatsächlich aber nur darauf aus, die Lebensgrundlage der Menschen dem kurzfristigen Gewinn zu opfern. Sie glaubt allein an das Machbare und den zivilisatorischen Fortschritt. Ingrid Bachér folgt allen Regeln der Kulturkritik, wenn sie einer so verstandenen Moderne die traditionale Welt der untergehenden Dörfer entgegenstellt: Hier legen sich die Menschen noch ausgestreckt auf die Erde, um die Einheit mit sich selbst und der Natur zu spüren. Als Teil einer agrarischen Kultur sind sie eingebunden in das organische Werden und Vergehen. Die sterbenden Dörfer haben in ihrer Mitte eine Kirche und mit dieser Rituale und einen Lebensrhythmus. Man fühlt sich der Geschichte eng verbunden und ist zugleich Teil der gegenwärtigen Gemeinschaft, wie sie sich auf einem letzten Schützenfest zeigt: im Lachen, Rufen und Reden, dem Lärm der Musikgruppen, den geschmückten Türen und Toren, Wimpeln und Fahnen im Wind.
Die Harmonie einer den Menschen umschließenden Welt hielten schon die Romantiker der sich differenzierenden Moderne entgegen, und seither ist sie in unzähligen Spielarten beschworen worden: die Hoffnung auf die Rückkehr eines Zustands, in dem das Ich in der Welt einen Widerhall findet, sich nicht stumm und kalt in ihr verloren fühlt. Ingrid Bachér gestaltet das alte Muster und geht dabei nicht immer subtil vor. So wird der Bruder der Erzählerin und Wortführer des Bürgerprotests aufdringlich als Märtyrer stilisiert. In den Schilderungen moderner Verluste lässt sich die Autorin Pathos durchgehen. Überraschend vehement wird auch der von der westdeutschen Linken lange verabschiedete Heimatbegriff wiederbelebt. Man darf ihn verwenden, wenn es gegen den Kapitalismus geht. Dies verbindet das Buch von Ingrid Bachér mit Reinhard Jirgls Roman "Die Stille", der auch Menschen beschreibt, die sich gegen Umsiedlung durch Braunkohletagebau wehren.
Bei allen Einwänden - auch gegen die manchmal simple politische Eindeutigkeit - bleibt die große Evidenz des Gegenstandes: Westlich von Grevenbroich breitet sich heute in Richtung Erkelenz die gewaltige Fläche aus, auf der jährlich 140 Millionen Kubikmeter Abraum, Löss, Kies und Sand bewegt werden. "Sie sahen dem unaufhörlichen Kreisen des Rades zu, an dem achtzehn Schaufeln hingen. Und sie hörten, wie sie die oberste Schicht des Feldes herausbrachen." Wo soll man die Ambivalenz der Moderne empfinden, wenn nicht angesichts einer solchen Grube?
SANDRA KERSCHBAUMER
Ingrid Bachér: "Die Grube". Roman. Dittrich Verlag. Berlin 2011. 174 S., geb., 17,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Die Ambivalenz der Moderne empfindet Rezensentin Sandra Kerschbaumer ja beim Lesen des Romans von Ingrid Bacher, wie soll man nicht angesichts der Drastik des Braunkohletagebaus, den das Buch schildert. Allerdings staunt Kerschbaumer doch, wie wenig subtil und mitunter pathosbeladen die Autorin bei der Darstellung des behandelten Konflikts zwischen Tagebau und niederrheinischer Heimat mitunter die alten Muster bedient, hier die zerstörerische Moderne, dort die mit der Scholle verwachsenen Menschen. Ein alter Topos fürwahr, meint Kerschbaumer, aber auch ein etwas simpler.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH