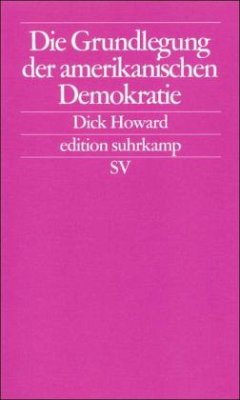Produktdetails
- edition suhrkamp 2148
- Verlag: Suhrkamp
- Seitenzahl: 388
- Deutsch
- Abmessung: 19mm x 109mm x 177mm
- Gewicht: 240g
- ISBN-13: 9783518121481
- ISBN-10: 3518121480
- Artikelnr.: 08204451
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Dick Howard erklärt Amerikas Revolution / Von Paul Nolte
Wie soll man Amerika verstehen? Aus welchem Reservoir der Geschichte schöpft dieses Land sein Verständnis der Gegenwart, schöpfen seine politischen Eliten ihre Weltbilder und Handlungsmuster? Die allgemeine, im ersten Augenblick verständlicherweise sehr emotional grundierte Solidarität mit den Vereinigten Staaten hat zunächst verdeckt, bald aber um so deutlicher hervortreten lassen, wie fremd vielen in Deutschland und Europa die Kategorien sind, in denen Amerika zumal in der zugespitzten Krise denkt und handelt. Die Symbole und Begriffe sind nicht die unseren. Mag man den Stellenwert der Flagge, des Star-Spangled Banner, noch halbwegs nachvollziehen können, kapituliert man spätestens vor der Frage, warum die Antwort auf den Terror in den Bahnen von Rache und Vergeltung konzipiert wird. Dafür müßte man nämlich das nur bis Pearl Harbor reichende historische Kurzzeitgedächtnis überschreiten und von einem im siebzehnten Jahrhundert geprägten alttestamentarischen Protestantismus sprechen, oder von den Gewaltmechanismen und Konfliktlösungen an der westlichen "frontier" im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert.
Deshalb erscheint das Buch von Dick Howard über die Entstehung der amerikanischen Demokratie und ihrer besonderen Politiktheorie in der Revolution des späten achtzehnten Jahrhunderts zur rechten Zeit in deutscher Übersetzung. Im Unterschied zur französischen scheint die amerikanische das Modell einer friedlichen und jederzeit kontrollierten Revolution zu liefern, einer Revolution der Verfassung und politischen Theorie statt der entfesselten sozialen Radikalisierung - einer Revolution, die gegen alle Versuchungen der totalitären Denkungsart gefeit war. Diese Gegenüberstellung reicht bis in die Revolutionszeit um 1800 selber zurück und ist in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts von Hannah Arendt einflußreich aufgegriffen worden. Daß die amerikanische Nation und Republik auf revolutionäre Ursprünge zurückführt, scheint in Deutschland besonders schwer vermittelbar zu sein. Zu stark ist der Mythos eines vermeintlich schon frei geborenen Landes, zu einprägsam der Topos von einer bruchlosen, kontinuierlichen Geschichte, die mit den vielen Brüchen und Regimewechseln der neueren deutschen Geschichte kontrastiert. Auch im historisch-politischen Selbstverständnis der Vereinigten Staaten spielt die revolutionäre Dimension der Ereignisse in den sechziger bis achtziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts eine auffallend geringe Rolle.
Ganz im Gegensatz zu diesem populären Bewußtsein hat die amerikanische Geschichtswissenschaft schon seit langem viel Energie darauf verwendet, die ganze Vielschichtigkeit des politisch-sozialen Geschehens zwischen den ersten Protesten gegen die englische Stempelsteuer 1765 und den Debatten über die Verfassung und die "Bill of Rights" dreieinhalb Jahrzehnte später zu rekonstruieren. Dabei haben Politik-, Ideen- und Sozialhistoriker durchaus an einem Strang gezogen. Während die Historiker der "republikanischen Synthese", auf die sich Howard besonders stützt, die revolutionäre Qualität des Bruches in politischer Theorie und Verfassung betonten, zeigten andere die Beteiligung breiter Volksschichten an Protesten, Petitionen und Parteiorganisationen auf. Im letzten Jahrzehnt, und deshalb von Howard noch nicht berücksichtigt, sind aus der Feder von Gordon Wood und Joyce Appleby eindrucksvolle Versuche hinzugekommen, diese beiden Ansätze zu einem Gesamtbild der tiefgreifenden Veränderungen des amerikanischen Lebensentwurfes durch die Revolution zu verbinden.
Nun ist Howard kein Historiker, sondern er betreibt Geschichtsschreibung in systematischer Absicht - ihm ist es um eine politische Theorie für die Gegenwart zu tun. Aber solche Grenzüberschreitungen sind oftmals höchst produktiv, und im allgemeinen bewegt der Autor sich durchaus sicher auf dem historischen Terrain. Seine Stärke liegt allerdings nicht in der präzisen Zusammenfassung komplexerer sozialer Strukturen und Handlungsabläufe, und seine Rezeption der einschlägigen Spezialliteratur ist begrenzt. Im Zentrum der historischen Analyse stehen vielmehr die Pamphlete und Programmschriften der Revolution, aus deren genauer Lektüre Howard eine politische Theorie der modernen amerikanischen Demokratie aus ihren vormodernen Ursprüngen herauszudestillieren versucht.
Dazu unterscheidet er drei Phasen der amerikanischen Revolution, denen jeweils ein Teil des Buches gewidmet ist. Zwischen 1765 und 1776 ging es zunächst "Auf dem Weg zur Unabhängigkeit" um fundamentale Rechte (die berühmten "Rights of Englishmen") und Souveränität. Die Unabhängigkeit mußte in einer zweiten Phase, zwischen 1775 und 1781/83, durch einen Krieg erst gesichert werden, und parallel dazu wurden die Grundlagen republikanischer Institutionen gelegt. Dabei galt es so fundamentale Probleme wie die "Repräsentation" des Volkes und das Verhältnis von Individuum und Gemeinwohl zu lösen. Die dritte Phase schließlich führt zur Bundesverfassung von 1787 und den großen Entscheidungen über die Repräsentation und über die Ausgewogenheit der Verfassungsorgane, die Howard als Schritt "von der republikanischen Politik zur liberalen Soziologie" interpretiert.
Das zentrale Argument des Buches jedoch offenbart sich in einem weiteren Dreischritt, der für jede der drei Phasen vollzogen wird. Der ruhige Erfolg der amerikanischen Revolution nämlich resultierte Howard zufolge aus einer Art Dialektik von "gelebter", "begriffener" und "reflektierter" Geschichte. Die Revolution hatte Zeit, und darin lag der Schlüssel zu ihrer Stabilisierung. Die neuen Erfahrungen, welche die Menschen in der "gelebten Geschichte" jeweils machten, konnten auf diese Weise verarbeitet und in politische Begriffe transformiert werden, und diese Transformation in Politik wurde dann als theoretische Reflexion gesteigert und zum Abschluß gebracht. "Die gelebte Erfahrung entspricht der unmittelbaren oder vorpolitischen Existenz", lautet ein Schlüsselsatz Howards. "Die in Begriffen gefaßte Form bringt die gesellschaftlichen Beziehungen zum Ausdruck, die durch diese gelebte Erfahrung eingerichtet worden sind. Und was als die Einheit dieser beiden Momente reflektiert wird, macht deren politische Tragweite deutlich."
An dieser Stelle setzen jedoch auch Zweifel an Howards eindrucksvollem Versuch ein. Welches Verständnis von Leben und Erfahrung steckt hinter seiner radikalen Trennung von Begreifen und theoretischer Reflexion? Vor allem ist schwer nachzuvollziehen, warum die "gelebte Erfahrung" einer "unmittelbaren" und "vorpolitischen" Existenz entsprechen soll - und zwar historisch ebenso wie politiktheoretisch: Die historische Forschung hat in den letzten Jahren eindrucksvoll gezeigt, wie die Politik der Revolution mit Erfahrung und Lebenswelt, mit Mentalität und Alltag ganz verschiedener sozialer Gruppen unauflöslich verknüpft war. An der Rekonstruktion dieser politischen Alltagserfahrung und ihrer Transformation in Republikanismus ist Howard kaum interessiert. Die gesellschaftlichen Grundlagen von Politik in der amerikanischen Revolution schneidet er ab, wie sich überhaupt ein eigentümliches Ressentiment gegenüber der Sphäre der "Gesellschaft" durch das Buch hindurchzieht.
Es geht nicht um den billigen Einwand, Howard habe keine Sozialgeschichte der amerikanischen Revolution geschrieben - was schließlich gar nicht seine Absicht war. Vielmehr geht es um grundsätzliche Entwürfe von Politik und Gesellschaft in der Demokratie, die hier aus der historischen Erfahrung für die Gegenwart und Zukunft der "Zivilgesellschaft" gewonnen werden sollen. Dick Howard folgt einer weitverbreiteten jüngeren Tendenz der linken Verfassungs- und Sozialtheorie, den Staat zu rehabilitieren und die Autonomie der Politik gegenüber der Gesellschaft dezidiert zu betonen. Man mag ihm sogar beipflichten, daß in der von ihm kritisierten Neigung zur "Antipolitik" die Trennung des Gesellschaftlichen vom Politischen zu weit gegangen ist, wenn die Demokratie nur noch als die "Gesellschaft, die direkt auf sich selbst einwirkte", verstanden wurde. Howard aber treibt nun seinerseits die Trennung des Politischen vom Gesellschaftlichen zu weit. Die Erfahrungen von 1989/90 in Osteuropa haben ihn darin bestätigt, daß die Aufhebung von Trennlinien zwischen Politik und Gesellschaft ein Einfallstor für totalitäre Ideologie und Praxis darstellt. Aber kann man daraus folgern, die Analyse der Politik von jeder Reflexion auf ihre gesellschaftlichen Grundlagen zu befreien?
Was die amerikanische Revolution betrifft, steckt dahinter vor allem ein verkürzendes Mißverständnis dessen, was Republik und Republikanismus im späten achtzehnten Jahrhundert gewesen ist und vielleicht immer noch ausmacht: nämlich nicht nur eine Verfassung, sondern im denkbar weitesten Sinne auch ein Gesellschaftsmodell. Eine Republik bedeutete eben nicht "einfach eine Gesellschaft ohne König oder Aristokratie", sondern einen elementaren Neuentwurf der sozialen Beziehungen, der ökonomischen Handlungshorizonte, des kulturellen Selbstverständnisses - und zwar noch vor dem Übergang zur Demokratie, der in Amerika erst seit dem frühen neunzehnten Jahrhundert wirklich erfolgte. Deswegen ist auch Howards Bevorzugung der "republikanischen Demokratie" vor der "demokratischen Republik" gerade im Falle Amerikas irreführend, das immer zuerst Republik war (und blieb), die sich dann sukzessive der Demokratie öffnete.
Auf einem anderen Blatt steht, was angesichts unserer Erfahrung der letzten Wochen nicht nur in Howards Buch zu kurz gekommen ist: die enge Verknüpfung von Revolution, Republik und Krieg in der amerikanischen Geschichte und politischen Kultur. In Krieg und Bürgerkrieg ist die Nation und ihre politische Freiheit begründet, nach außen verteidigt und nach innen zusammengehalten worden. Ein kluger Kopf wie Howard sollte sich in Zukunft einmal diesem Problem historisch und theoretisch widmen.
Dick Howard: "Die Grundlegung der amerikanischen Demokratie". Aus dem Amerikanischen von Ulrich Rödel. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001. 388 S., br., 29,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Insgesamt recht überzeugend findet der Rezensent Andreas Bock die Thesen des Philosophen und Politikwissenschaftlers Dick Howard. Der beschäftigt sich in seinem 1986 im Original erschienen Buch mit der Frage, warum der Versuch geglückt ist, in Amerika nach der Trennung von der englischen Krone eine Demokratie zu schaffen. Howard sieht den Grund für das Gelingen dieses Projektes darin, dass private Interessen, der "pursuit of happiness", in dem neuen Staat im Vordergrund standen und dass es beim Ausarbeiten der Verfassung keine klare Vorstellung davon gab, wie der neue Staat auszusehen hat. Somit waren alle Entscheidungen von praktischen Erfahrungen motiviert. Die Art und Weise, wie Howard seine Thesen vertritt, findet Andreas Bock ebenso "belesen wie belehrt". Allerdings vermisst der Rezensent ein paar negative Anmerkungen im Geiste Hannah Arendts zum Thema "pursuit of happiness", weil dieser sich doch eben schnell zu einer hauptsächlich materiellen Doktrin entwickelt habe.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH