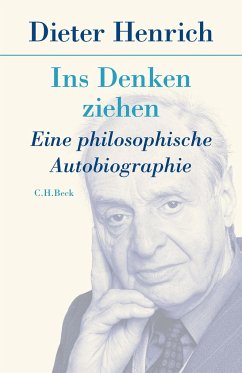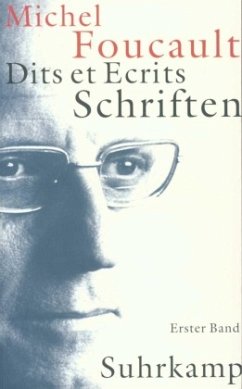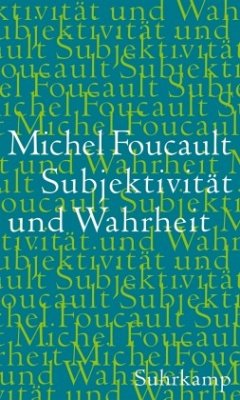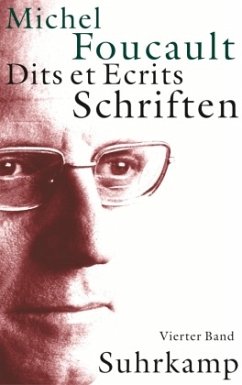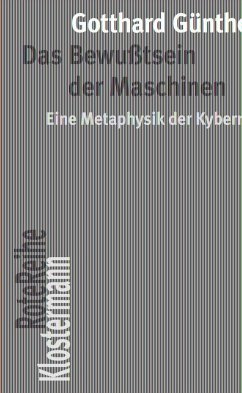Die Guattari-Tapes
Gespräche mit Antonio Negri, Jean Oury, Jean-Claude Polack, Élisabeth Roudinesco, Danielle Sivadon und Paul Virilio
Übersetzung: Voullié, Ronald
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
14,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Félix Guattari (1930-1992) ist insbesondere als Ko-Autor von Gilles Deleuze berühmt geworden. Sein eigenes Werk ist dagegen schwerer zu fassen. Anders als Deleuze war Guattari kein Universitätsphilosoph, und obwohl er zeit seines Lebens in der psychiatrischen Klinik "La Borde" arbeitete, war er weder Neurologe noch Psychiater, sondern: Maschinentheoretiker, Schizoanalytiker und ein Kartograph chaosmotischer Subjektivitäten. Im klinischen Alltag, aber auch in der politischen Aktion galt sein brennendes Interesse dem konkreten Verhältnis von Körper und Technik und der kritischen Verbindung...
Félix Guattari (1930-1992) ist insbesondere als Ko-Autor von Gilles Deleuze berühmt geworden. Sein eigenes Werk ist dagegen schwerer zu fassen. Anders als Deleuze war Guattari kein Universitätsphilosoph, und obwohl er zeit seines Lebens in der psychiatrischen Klinik "La Borde" arbeitete, war er weder Neurologe noch Psychiater, sondern: Maschinentheoretiker, Schizoanalytiker und ein Kartograph chaosmotischer Subjektivitäten. Im klinischen Alltag, aber auch in der politischen Aktion galt sein brennendes Interesse dem konkreten Verhältnis von Körper und Technik und der kritischen Verbindung von Ökonomie und Ökologie. Genau darin liegt die ungebrochene Aktualität seiner Arbeit, in die dieser Band anhand von sechs Gesprächen einführt, die einen Lebensweg skizzieren, der zwischen Theorie und Praxis ebenso überzeugend changierte wie zwischen Individuum und Kollektiv.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.