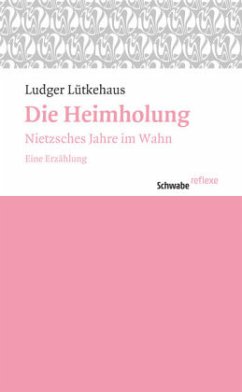'Als meine Mutter lebe ich noch und werde alt.'(Nietzsche)Die Umstände von Friedrich Nietzsches (1844-1900) Zusammenbruch im Januar 1889 hätten dramatischer kaum sein können: Innert weniger Tage versendet er Dutzende von Briefen, unterzeichnet mit 'Nietzsche Caesar', 'Der Gekreuzigte' oder 'Dionysos ', in denen er unter anderem seinen Willen verkündet, 'den jungen Kaiser füsillieren', 'alle Antisemiten' und 'Bismarck [...] erschießen' oder gar den 'Papst ins Gefängniß' werfen zu lassen. Kurz nach diesen sogenannten 'Wahnsinnszetteln' verfällt der Philosoph für den Rest seines Lebens in beinahe vollständige geistige Umnachtung. Fortan kümmert sich die Mutter liebevoll und aufopfernd um den Kranken - aber mitnichten selbstlos: Denn fast scheint es, als sei dessen Leiden für die Pastorenwitwe eine willkommene Gelegenheit, den an Atheismus und Freigeisterei verloren geglaubten Sohn auf die frommen Pfade des ländlichen Protestantismus, seiner geistlichen und familiären Heimat, zurückzuführen.Aus der Perspektive der Mutter, in der jedoch die Stimme des Sohnes unterschwellig hörbar bleibt, erzählt Die Heimholung von einem abgründigen, zutiefst ambivalenten Beziehungsdrama - und einer Liebesgeschichte.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Beatrice Eichmann-Leutenegger schwelgt in der eleganten Prosa des Autors, der hier sein gesammeltes Wissen über Nietzsche auf die spezielle Mutter-Sohn-Beziehung fokussiert. Die Art und Weise, wie Ludger Lütkehaus Nietzsches letzte Jahre in der Obhut seiner Mutter in die biografische Erzählung fasst, besticht laut Rezensentin durch eine überzeugende Darstellung von Einzelheiten aus dem Leben Franziska Nietzsches. So gelingt es Lütkehaus, ihren Gottesbegriff und ihren Verständnishorizont anschaulich zu machen. Ferner schätzt Eichmann-Leutenegger die atmosphärische Dichte der Erzählung und das in sie eingeflossene historische Wissen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH