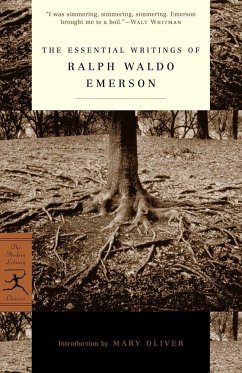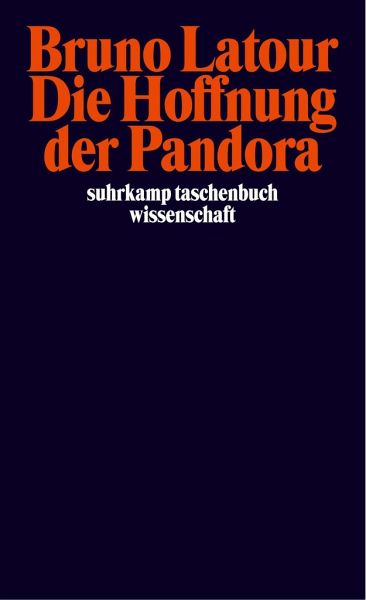
Die Hoffnung der Pandora
Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft
Mitarbeit: Latour, Bruno;Übersetzung: Roßler, Gustav
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
22,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Glaubst du an die Wirklichkeit?" Diese Frage eines Kollegen verwunderte Bruno Latour. In diesem Buch liefert er seine detaillierte Antwort. Anhand verschiedener Fallstudien - eine bodenkundliche Expedition im Regenwald des Amazonas, die französische Atomforschung kurz vor der Okkupation, die Entdeckung des Milchsäureferments durch Pasteur - nimmt Latour die vieldiskutierte Frage auf, ob die im Labor gewonnen Tatsachen "konstruiert" oder "wirklich" sind. Doch bereits diese Frage soll vor allem eine polemische Form des wissenschaftlichen "Objekts" begründen und ist Teil der gegenwärtigen "S...
"Glaubst du an die Wirklichkeit?" Diese Frage eines Kollegen verwunderte Bruno Latour. In diesem Buch liefert er seine detaillierte Antwort. Anhand verschiedener Fallstudien - eine bodenkundliche Expedition im Regenwald des Amazonas, die französische Atomforschung kurz vor der Okkupation, die Entdeckung des Milchsäureferments durch Pasteur - nimmt Latour die vieldiskutierte Frage auf, ob die im Labor gewonnen Tatsachen "konstruiert" oder "wirklich" sind. Doch bereits diese Frage soll vor allem eine polemische Form des wissenschaftlichen "Objekts" begründen und ist Teil der gegenwärtigen "Science Wars", die er bis in die Antike verfolgt. Bei aller Instrumentalisierung der Wissenschaften zum Zweck der Bevormundung, ist Latour dennoch kein Wissenschaftsgegner, sondern für die Forschung in ihrem offenen Experimentieren.