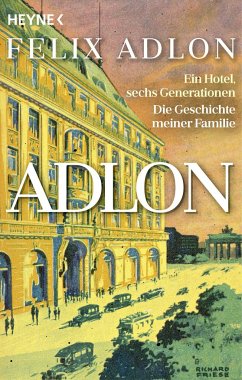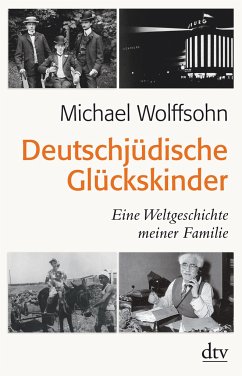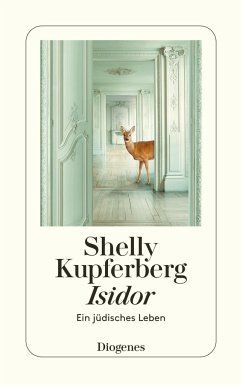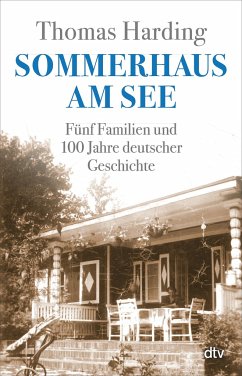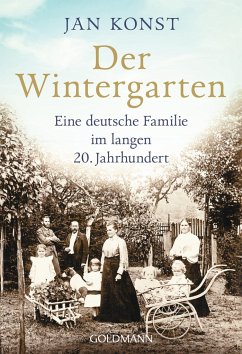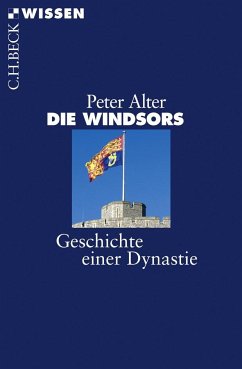Stephan Malinowski
Broschiertes Buch
Die Hohenzollern und die Nazis
Geschichte einer Kollaboration Ausgezeichnet mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2022

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





"Stephan Malinowski [erzählt] für das große Publikum, wie Mitglieder der Monarchenfamilie zu Steigbügelhaltern Hitlers wurden." Lothar Müller, Süddeutsche ZeitungSeit über 100 Jahren haben die »Oberhäupter« der Hohenzollern immer wieder mit Juristen, Historikern, Journalisten, Ghostwritern und PR-Beratern zusammengearbeitet, mit deren Hilfe sie das Bild der Familie in der Öffentlichkeit aufpolierten. Nun werden Rollen und Selbstdarstellung der wichtigsten Familienmitglieder von einem der besten Kenner der Materie erstmals analysiert und dargestellt: In einer großen historischen Erz...
"Stephan Malinowski [erzählt] für das große Publikum, wie Mitglieder der Monarchenfamilie zu Steigbügelhaltern Hitlers wurden." Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung
Seit über 100 Jahren haben die »Oberhäupter« der Hohenzollern immer wieder mit Juristen, Historikern, Journalisten, Ghostwritern und PR-Beratern zusammengearbeitet, mit deren Hilfe sie das Bild der Familie in der Öffentlichkeit aufpolierten. Nun werden Rollen und Selbstdarstellung der wichtigsten Familienmitglieder von einem der besten Kenner der Materie erstmals analysiert und dargestellt: In einer großen historischen Erzählung zieht Stephan Malinowski den Bogen über drei Generationen von 1918 bis in die Gegenwart und beschreibt das politische Milieu, in dem sich ihre Akteure bewegten.
Seit über 100 Jahren haben die »Oberhäupter« der Hohenzollern immer wieder mit Juristen, Historikern, Journalisten, Ghostwritern und PR-Beratern zusammengearbeitet, mit deren Hilfe sie das Bild der Familie in der Öffentlichkeit aufpolierten. Nun werden Rollen und Selbstdarstellung der wichtigsten Familienmitglieder von einem der besten Kenner der Materie erstmals analysiert und dargestellt: In einer großen historischen Erzählung zieht Stephan Malinowski den Bogen über drei Generationen von 1918 bis in die Gegenwart und beschreibt das politische Milieu, in dem sich ihre Akteure bewegten.
Stephan Malinowski, geboren 1966 in Berlin, studierte und lehrte Geschichte in Berlin, Frankreich, Italien, den USA, Irland und Großbritannien. Sein Buch Vom König zum Führer über den deutschen Adel und die NS-Bewegung wurde mit dem Hans-Rosenberg-Preis ausgezeichnet. Das Gutachten, das er im Auftrag des Landes Brandenburg erstellte, spielte in der Diskussion um die vom 'Chef des Hauses' Hohenzollern geltend gemachten Restitutionsansprüche eine zentrale Rolle.
Produktdetails
- Verlag: Ullstein TB
- Auflage
- Seitenzahl: 752
- Erscheinungstermin: 25. April 2024
- Deutsch
- Abmessung: 207mm x 135mm x 51mm
- Gewicht: 648g
- ISBN-13: 9783548068411
- ISBN-10: 3548068413
- Artikelnr.: 69176269
Herstellerkennzeichnung
Ullstein Taschenbuchvlg.
Friedrichstraße 126
10117 Berlin
Info@Ullstein-Buchverlage.de
»Stephan Malinowskis brillantem Buch gelingt ein Gleichgewicht zwischen der forensischen Analyse individuellen Verhaltens und einem neuen Verständnis dafür, wie die giftige politische Kultur einer besiegten Monarchie dazu beitrug, die Demokratie in Deutschland zu zerstören.« Christopher Clark Die Zeit 20211007
eBook, ePUB
Die große „Familie“ der Hohenzollern war und ist stets bemüht, sich im rechten Licht darzustellen. Sie engagieren Journalisten, Reporter und PR-Berater. Jedoch müssen sie sich gefallen lassen, dass auch ihre polierte Seite einige Macken hat. Wie war denn der Kaiser …
Mehr
Die große „Familie“ der Hohenzollern war und ist stets bemüht, sich im rechten Licht darzustellen. Sie engagieren Journalisten, Reporter und PR-Berater. Jedoch müssen sie sich gefallen lassen, dass auch ihre polierte Seite einige Macken hat. Wie war denn der Kaiser tatsächlich? Also, wie stand er zu den Nationalsozialisten und wie verbrachte er seine Zeit im „Exil“? Welche Fotografien von ihm und seinen Söhnen wurden nur für´s Volk gemacht und veröffentlicht. Eine spannende Reise in die Vergangenheit und Antworten auf viele Fragen bietet das Buch „Die Hohenzollern und die Nazis“. Der Autor Stephan Malinowski schaffte es damit auf den ersten Platz beim #DSP22. Herzlichen Glückwunsch.
Dass Kaiser Wilhelm abdanken musste und in die Niederlande floh, lernten wir in der Schule. Wie er dort seine Zeit verbrachte und was derweil die Söhne umtrieb, das kommt erst nach und nach ans Licht. Bis heute gibt es immer wieder Schriften, die auch für dieses Buch als Grundlage dienten. Es gilt als erwiesen, dass die Hohenzollern aktiv tätig waren, die Nationalsozialisten bei ihrem Streben nach Macht zu unterstützen. Der Autor nennt es gar eine „symbolisch – politische Allianz“. In dem Sachbuch werden Republikfeinde beim Namen genannt und der Aufstieg Hitlers konkretisiert.
Noch ein Zitat, welches die Verbundenheit des Kaiserhauses zu Hitler zeigt:
„Lieber Herr Hitler! ….führen Sie diese herrliche nationale Bewegung hinein in die fruchtbringende Arbeit.“ Das schrieb der Kronprinz Wilhelm an sein Vorbild.
Viele Quellen berichten davon und sie wurden von Herrn Malinowski gefunden und zur Unterstreichung der Wahrheit herangezogen. Zudem konnte er auch etliche Fotos nutzen und damit das Buch noch abwechslungsreicher gestalten.
Es gibt ja Sachbücher, die lassen sich nur mühsam lesen. Ihre Schöpfer zeigen dabei häufig, dass sie Latein lernten oder wissenschaftliche Zusammenhänge in der Quantenchemie kennen. Also, nichts für Menschen, die kein Studium abschlossen oder sich auf ein Thema fixierten.
„Die Hohenzollern und die Nazis“ hebt sich wohltuend davon ab. Die Sprache ist gehoben aber niemals abgehoben. Neben trockenen Passagen gibt es immer wieder humorvolle Abschnitte, die das Lesen zu einem Vergnügen machten. Meine Empfehlung für dieses Werk gilt ohne Abstriche. Für alle, die sich für die Historie Deutschlands ab 1918 interessieren eigentlich ein Muss.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Der Unterkiefer reagiert beim Lesen wie der Klappentext: er klappt nach unten...
Der am Ende des Ersten Weltkrieges nach der vollständigen Kapitulation des Deutschen (Kaiser-) Reiches ins Exil nach Holland geflüchtete Kaiser von Deutschland und König von Preußen Wilhelm II …
Mehr
Der Unterkiefer reagiert beim Lesen wie der Klappentext: er klappt nach unten...
Der am Ende des Ersten Weltkrieges nach der vollständigen Kapitulation des Deutschen (Kaiser-) Reiches ins Exil nach Holland geflüchtete Kaiser von Deutschland und König von Preußen Wilhelm II lebte bis zu seinem Tod 1941 nicht nur in Doorn (NL), sondern auch in einer gewissen Wahnwelt. In der er ausser einer seiner Hauptbeschäftigungen des Holzhackens noch immer davon überzeugt war (oder zumindest davon träumte), nach seiner Rückkehr nach Deutschland wieder Kaiser werden zu können.
Am Ausbruch von WK I hatten alle anderen Schuld - er nicht im Geringsten. Die Weimarer Republik, an deren Untergang, besser an deren Vernichtung er nach Kräften mitwirkte, musste in seinen Augen beseitigt werden. Wobei er, Wilhelm II samt seinen Familienmitgliedern, sich den Nationalsozialisten und Adolf Hitler durchaus andiente. Mitgliedschaft im 'Stahlhelm'? Kein Problem, Hauptsache die Weimarer Republik wird beseitigt. Mitgliedschaft in der SA, Fotos des Ex-Kronprinzen auf Nazi-Großveranstaltungen, in Nazi-Uniform mit Hakenkreuzbinde am linken Oberarm, der Ex-Kronprinz im Gespräch mit Goehring, der Ex-Kronprinz neben Goebbels, der Ex-Kronprinz neben Ernst Röhm marschierend und so weiter.
Noch weiter klappt der Unterkiefer runter, wenn man die weiteren Verhaltensweisen und vor allem auch die Reaktionen in der jungen Bundesrepublik liest. Zum Beispiel Teiler der 1986er Politprominenz auf Schloss Hechingen bei der Trauerfeier zum 100sten Geburtstag Wilhelm II...
Wem dann nach einem noch weiter herunter klappenden Unterkiefer zumute ist, der suche im Netz einfach mal in Kombination nach den Stichworten 'Böhmermann Hohenzollern'.
In seinem sehenswerten 28 Minuten dauernden Beitrag setzt sich der Satiriker Jan Böhmermann mit den Entschädigungsforderungen des Hauses Hohenzollern für die in der SBZ, späteren DDR enteigneten Besitztümer des edlen Hauses auseinander. Einschliesslich des kaiserlichen Befehls zum ersten Genozid Deutschlands. An den Herero.
Fazit:
Erstens laufen jetzt alle Verfasser positiver Rezensionen an diesem Buch Gefahr, vom 'Chef des Hauses' beziehungsweise den beauftragten Anwälten juristisch belangt zu werden.
Zweitens ist es nicht nachvollziehbar, mit welcher bodenlosen Frechheit an den indirekten Nachfolger der Weimarer Republik, also an die Bundesrepublik Deutschland Entschädigungsforderungen in sagenhafter Höhe gestellt werden. Gestellt werden können und sich Gerichte mit diesen Forderungen auseinandersetzen müssen. Wobei zu beachten ist, dass das Haus Hohenzollern aktiv an der Beseitigung der Weimarer Republik mitgewirkt hat, die Nazis protegiert hat, somit auch am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wahrlich nicht unschuldig ist - jetzt aber Forderungen zur Entschädigung stellt... Verstehe das, wer wolle!
Drittens: das Hohenzollernschloß in Sigmaringen, die Burg Hohenzollern bei Hechingen sieht man plötzlich doch mit ganz anderen Augen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Als jemand, der am Fuß von Burg Hohenzollern in Hechingen aufgewachsen ist, hat mich „Die Hohenzollern und die Nazis“ von Stephan Malinowski natürlich sehr interessiert. Und, obwohl es ein Sachbuch ist, hat mich das Buch von der ersten Seite in seinen Bann gezogen. Viel wusste …
Mehr
Als jemand, der am Fuß von Burg Hohenzollern in Hechingen aufgewachsen ist, hat mich „Die Hohenzollern und die Nazis“ von Stephan Malinowski natürlich sehr interessiert. Und, obwohl es ein Sachbuch ist, hat mich das Buch von der ersten Seite in seinen Bann gezogen. Viel wusste ich über den örtlichen Adel abgesehen von den Besuchen ihrer Burgen in Hechingen und Sigmaringen nicht. Und da ich nicht dabei war und kein Historiker bin, muss ich mich drauf verlassen, dass es stimmt, was Stephan Malinowski schreibt, schließlich hat er jahrelang recherchiert. Daher kann und möchte ich auf den Wahrheitsgehalt seines Buchs nicht eingehen. Fakt ist aber, dass er seine Thesen mit zahlreichen Quellen untermauert. Herausgekommen ist ein lesenswertes Buch über Adel, antidemokratische, antisemitische, reaktionäre und national(sozial)istische Gesinnungen, Geltungssucht und rücksichtsloses Machtstreben.
Aber von vorn.
Der Streit des Hauses Hohenzollern um Entschädigungen für die Besitztümer, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland, also der Sowjetisch Besetzten Zone, enteignet worden sind, zieht sich nun schon seit 2014 und die Debatte zieht weite Kreise, auch in den Medien. Einer der Gutachter in der Sache ist der Historiker Stephan Malinowski, der im Auftrag des Landes Brandenburg beleuchten sollte, ob und inwiefern Wilhelm Kronprinz von Preußen seinerzeit dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet hat (Titel: „Gutachten zum politischen Verhalten des ehemaligen Kronprinzen Wilhelm Prinz von Preußen (1882-1951)“). Das Gutachten wurde vom Haus Hohenzollern angefochten, das Malinowski (und in anderen Zusammenhängen einige seiner Kollegen) anzeigte. Seine Ergebnisse konnten dem Adelsgeschlecht natürlich nicht gefallen, denn der Historiker kam zum eindeutigen Schluss, dass die Hohenzollern nicht nur nichts gegen den Vormarsch der Nationalsozialisten tat, sondern sogar vielmehr ein „Werbeträger“ für die Nazis war. Schließlich hatte man eines ganz sicher gemeinsam: die Ablehnung der Republik, wobei das Haus Hohenzollern natürlich auf eine Wiederkehr der Monarchie hoffte.
Auch wenn das Haus Hohenzollern mit autorisierten Texten in der Zeit nach 1945 immer wieder versucht hat, die Weste weiß zu waschen und das öffentliche Image aufzupolieren, so zeichnet Stephan Malinowski ein anderes Bild der drei Generationen von 1918 bis heute. Pointiert, brillant und manchmal fast süffisant schreibt er in seinen sechs Kapiteln erst über sehr viel Privatleben, dann aber über „Paktieren“, ja sogar von „Anbiederung bei den Nazis“. Später wurde die Rolle relativiert und als „unbedeutend“ („Der Einfluss des insgesamt unbedeutenden Kronprinzen habe nur einen kurzen Zeitraum umfasst“) dargestellt, in den 1950er Jahren entstand sogar das Narrativ, die Hohenzollern seien ein Teil des Widerstandes gewesen. In seinem Buch stützt sich Malinowski aber überwiegend auf historische Quellen, die die Außenwirkung der Hohenzollern zeigen. Er zitiert Zeitungsartikel und Veröffentlichungen aus dem In- und Ausland, die ihre Nähe zu den Nazis nach 1933 aufzeigen. Bei der Lektüre stellt man fest, dass die Beziehung eine symbiotische war, denn beide Seiten hatten mehr gemeinsam, als die Hohenzollern heute sehen wollen und beide wollten von ihrer Kollaboration auf ihre Weise profitieren.
Wohlformuliert und für ein Sachbuch sehr verständlich geschrieben, zerlegt der Autor die Geschichte der Hohenzollern in ihre (nachweis- und nachvollziehbaren) Einzelteile und zerlegt damit größtenteils ihr Narrativ. Das Hühnchen, das er selbst wegen der Strafanzeige mit den Adligen zu rupfen hat, und das seine Ausführungen vorurteilsbelastet machen könnten, erwähnt er erst gegen Schluss, wo er auf seinen eigenen juristischen Streit mit der Familie eingeht. Sonst bleibt er ausschließlich auf dem Boden der Fakten. Für mich war das Buch eine lohnende und aufschlussreiche Lektüre, die ich für Geschichtsinteressierte gerne weiterempfehle. Von mir fünf Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Zum Hintergrund: Seit 2014 laufen Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der Familie Hohenzollern, die sich auf das sog. Ausgleichsleistungsgesetz beruft und Ansprüche auf Schlösser, Liegenschaften, Tausende von Kunstschätzen und andere Vermögenswerte erhebt, die nach dem …
Mehr
Zum Hintergrund: Seit 2014 laufen Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der Familie Hohenzollern, die sich auf das sog. Ausgleichsleistungsgesetz beruft und Ansprüche auf Schlösser, Liegenschaften, Tausende von Kunstschätzen und andere Vermögenswerte erhebt, die nach dem II. Weltkrieg von der Sowjetischen Militäradministration enteignet wurden. Malinowski wurde mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt zur Frage, ob der Ex-Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus „erheblichen Vorschub“ geleistet habe. Wenn ja, wären Leistungen nach diesem Gesetz ausgeschlossen. Diese sog. Hohenzollerndebatte entwickelte sich in den Folgejahren zum „bedeutendsten geschichtspolitischen Konflikt des Landes“ (SPIEGEL). Malinowski und Journalisten wurden von den Hohenzollern mehrfach verklagt.
Das vorliegende Buch basiert auf den Ergebnissen des Gutachtens.
Gleich zu Beginn stellt der Autor klar, dass er sein Buch nicht auf die Frage der Vorschubleistung reduziert sehen will. Er betrachtet sein Buch eher als Fallstudie, in der er die Handlungen einer hochadligen Familie mit der historischen Methode untersucht. Der Autor legt seine Darstellung daher breit an und beginnt mit dem Exil des Kaisers Wilhelm II. und des Kronprinzen Wilhelm in den Niederlanden und beobachtet ebenfalls das Agieren der Familie und der Vertrauten. Ein wesentlicher Untersuchungsgegenstand ist dabei die Kommunikation zwischen den Hohenzollern und der Öffentlichkeit. Der Autor betont die Bedeutung der Selbstdarstellung bzw. Performance für das Bild, das die Hohenzollern der Öffentlichkeit bieten wollten. Die war nicht immer leicht zu meistern; so ließ sich z. B. die Fahnenflucht des Kaisers und des Thronfolgers in den folgenden Jahren nur schwer vermitteln. Ein breit aufgestellter Stab an PR-Beratern, Ghostwritern, Journalisten, Juristen etc. sorgte für das gewünschte Außenbild der Figur.
Malinowski legt akribisch dar, wie die Hohenzollern die Hoffnung auf eine Restitution der Monarchie nicht aufgaben und wie sie sich zum Steigbügelhalter der Nationalsozialisten machten. Dazu nutzen sie ihren charismatischen Namen, der Sehnsüchte und Volk hervorruft, die den Kyffhäuser-Mythos assoziieren lassen, wobei die Namensträger allerdings von Charakter und Leistung her diesen Erwartungen nicht gerecht werden. Zusätzlich nutzen sie die informellen Kommunikationsmöglichkeiten des Adels bzw. Hochadels, wie sich bei Jagdgesellschaften, Bällen, in den Clubs, den Offizierkasinos etc. ergaben. Die Verbindung des nationalen mit dem konservativen Lager glückt, und der Tag von Potsdam, an dessen Inszenierung auch die Hohenzollern beteiligt sind, zeigt eindrucksvoll den Schulterschluss von Alt und Neu. Die nächsten Jahre sind gekennzeichnet von Anbiederungsversuchen, Anpassungen und Arrangements. Nach wie vor stellen die Hohenzollern dem Regime ihre jahrhundertealte Geschichte, ihr Charisma und den Glanz ihres Namens zur Verfügung. Trotzdem reicht der Einfluss nicht so weit, um im arrivierten NS-System eine bedeutende Rolle zu spielen.
Liest man die Quellen, die Malinowski anführt, fällt es schwer, an die imaginierte Opferrolle der Hohenzollern zu glauben. Da werden die Verhaftungen von Kommunisten, Sozialisten, Juden und anderen „Volksfeinden“ als „Aufräumarbeiten“ abgetan, Mussolini wird wegen seiner „genialen Brutalität“ bewundert, schon in den 20er Jahren sind Hitler, Röhm und Göring Gast im Cecilienhof, Wahlaufrufe für Hitler, Sätze wie „Jetzt heißt es, jedem in die Fresse zu hauen“, der die Regierung Hitler angreife, Geldzuwendungen, Assistenz im SA-Folterkeller, eine Fülle an Bildmaterial etc. – Malinowski stützt seine Darlegungen auf eine breite Quellenlage, die er genau auswertet und zugleich die apologetischen Ausführungen anderer Historiker widerlegt. Sein Urteil: Es dürfte "auch im Adel aller Sparten nur wenige Familien gegeben haben, die so geschlossen, so stetig, so radikal und so wirkungsvoll gegen die Republik und ihre Prinzipien aufgetreten sind wie die polit
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Nie und nimmer
Wenn die Rückgabe des Grundbesitzes der Hohenzollern diskutiert wird, kommt die Frage auf, ob die ehemalige Kaiserfamilie der Nazi- Herrschaft Vorschub geleistet habe. Und wer dieses Buch gelesen hat, wird zu dem Ergebnis kommen, dass die Bundesrepublik nie und nimmer den …
Mehr
Nie und nimmer
Wenn die Rückgabe des Grundbesitzes der Hohenzollern diskutiert wird, kommt die Frage auf, ob die ehemalige Kaiserfamilie der Nazi- Herrschaft Vorschub geleistet habe. Und wer dieses Buch gelesen hat, wird zu dem Ergebnis kommen, dass die Bundesrepublik nie und nimmer den Hohenzollern ihren Besitz zurückgeben darf.
Das Verhalten von Kaiser und Kronprinz im Ersten Weltkrieg nicht an der Front zu fallen, sondern in den Niederlanden Asyl zu suchen kann ich nachvollziehen. Nachvollziehen kann ich auch, dass der Ex-Kronprinz nach seiner Rückkehr von er Wiederherstellung der Monarchie träumte. Doch der Autor legt plausibel dar, dass trotz Monarchiewillen in weiten Teilen der Bevölkerung weder der wankelmütige, frauenumwerbende Kronprinz noch sein Vater noch ein anderes Familienmitglied als Monarch in Frage kam.
Weit schlimmer ist aber, dass der Ex-Kronprinz als Mitglied der Stahlhelm-Bewegung sich um die Einheit der konservativen Bewegung bemühte und schon vor der Machtübernahme der Nazis sich mit Hakenkreuzen zeigte. Nie hatte die Hohenzollern-Familie eine Beziehung zur Weimarer Republik gefunden.
Als die Nazis während ihrer Regierung schnell dafür sorgten, dass ohne öffentliche Berichterstattung das Interesse am Ex-Königshaus sank, setzte auch kein Widerstand ein. Ebenso wenig schadete der Gewaltherrschaft, dass ein Enkel des letzten Kaisers an der Front fiel und auch die Beteiligung der Hohenzollern am Attentat des 20. Julis gehört in das Reich der Fabel.
Nach dem Krieg inszenierte sich die Familie weiter als zum Widerstand gehörig oder wie Historiker Clark als unbedeutend. Doch auch unzählige Gerichtsverfahren können den Autor Malinkowski nicht widerlegen.
Dieses Buch erhielt den Deutschen Sachbuchpreis 2022 und das völlig zu Recht. Da mich dieses Thema nur am Rande interessiert, fand ich es manchmal etwas zu ausführlich, aber das kann ich keinem Sachbuch vorwerfen, nein von Herzen 5 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für