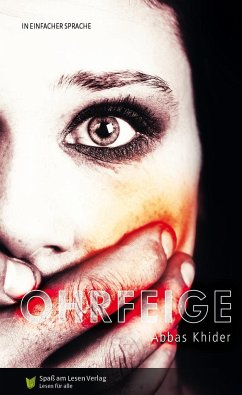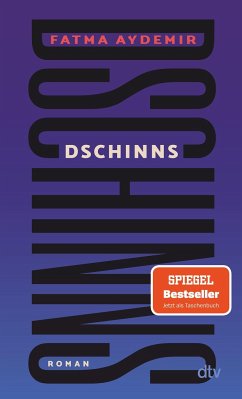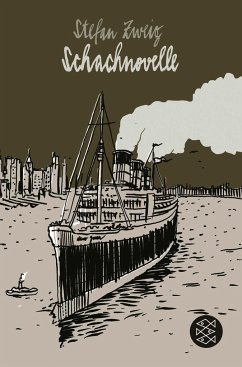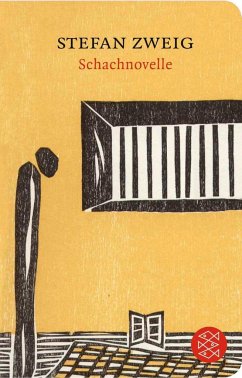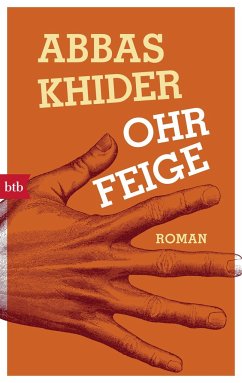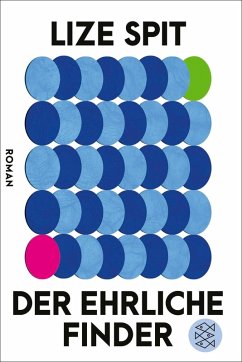Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!




Ein Bundesinnenminister aus Bayern, der menschenfreundlich und pragmatisch handelt. Ein karrieregeiler Staatssekretär, der Küchenkataloge lesen muss und am alljährlichen Sommerloch leidet. Ein Kanzler, der kein Merkel mehr ist. Nie war Deutschland hilfloser. Ausgerechnet in dieser prekären Lage entdeckt eine Trash-TV-Moderatorin ihr Herz für Arme und will die Welt zu einem besseren Ort machen. Und jetzt?
Timur Vermes wurde 1967 in Nürnberg als Sohn einer Deutschen und eines Ungarn geboren. Er studierte in Erlangen Geschichte und Politik und arbeitete anschließend als Journalist und Ghostwriter. Er schrieb bis 2001 für die ABENDZEITUNG und den Kölner EXPRESS, später für mehrere Magazine. Sein Roman "Er ist wieder da" (2012) war eines der erfolgreichsten deutschen Debüts der letzten Jahrzehnte.
Produktdetails
- Bastei Lübbe Taschenbücher 17886
- Verlag: Bastei Lübbe
- Originaltitel: Die Hungrigen und die Satten
- Artikelnr. des Verlages: 17886
- 1. Aufl.
- Seitenzahl: 512
- Erscheinungstermin: 31. Oktober 2019
- Deutsch
- Abmessung: 187mm x 128mm x 35mm
- Gewicht: 425g
- ISBN-13: 9783404178865
- ISBN-10: 3404178866
- Artikelnr.: 56542565
Herstellerkennzeichnung
Lübbe
Schanzenstraße 6-20
51063 Köln
vertrieb@luebbe.de
Den neuen Roman von Timur Vermes habe ich sehr gern gehört und empfehle das Hörbuch wärmstens auch weiter.
Timur Vermes ist eine geniale Gesellschaftssatire gelungen, die dem Publikum Spiegel vors Gesicht hält: klug, mit Niveau, bis zu den Wurzeln der Dinge durchblickend, …
Mehr
Den neuen Roman von Timur Vermes habe ich sehr gern gehört und empfehle das Hörbuch wärmstens auch weiter.
Timur Vermes ist eine geniale Gesellschaftssatire gelungen, die dem Publikum Spiegel vors Gesicht hält: klug, mit Niveau, bis zu den Wurzeln der Dinge durchblickend, ironisch-sarkastisch, schonungslos. Die erste Hälfte hörte ich dauerschmunzelnd, paarmal musste ich auflachen. Zum Schluss wurde es immer ernster.
Christoph Maria Herbst hat kongenial gelesen. Hörgenuss auf der ganzen Linie, 15 St. 13 Min. der ungekürzten Ausgabe.
Die Handlung spielt in naher Zukunft. Für weitere Inhaltsangaben s. Klappentext. Der beschreibt das Wesentliche sehr treffend.
Sowohl die Figuren als auch die Handlung sind sehr überzeugend, alles hat Hand und Fuß. Von den Figuren gibt es meist die schrägen, bei denen man anfangs des Öfteren auflacht. Alles hat Sinn und einen festen Platz in der Handlung.
Oft wurde zwischen den Figuren geschaltet, aber umso spannender und abwechslungsreicher wurde das Ganze.
Viele Politiker kommen hier vor, zwar unter anderen Namen oder gar ohne welche, wie der Nachfolger von Merkel, der in etwa so auch genannt wurde, aber man kommt schon dahinter, wer eigentlich gemeint ist, auch weil C.M. Herbst dies mit seiner Darbietung nahelegt.
Der Privatsender, der die Starmoderatorin in das Flüchtlingslager schickt, ist eine der tragenden Figuren und offenbart viel Intimes im Verhältnis privates Medium und seine Zuschauer. Schön bissig, schonungslos die Tatsachen offenbarend und stets auf den Punkt. Wenn man auf diese Seite des Geschehens achtet, bekommt man viel Wahres in der Hinsicht vermittelt. Diese Geschichten von Astrid von Roel, die für die Starmoderatorin schreibt! So genau auf die Zielgruppe der Privatsenderzuschauer zugeschnitten, Werbung und alles, was damit zu tun hat inkl.
Nach und nach sieht man den Unterschied, die Kluft zwischen der rauen Realität und dem, was der Sender an sein Publikum vermittelt. Welch haarsträubenden Märchen da erzählt werden. Eklatant, auf welch Nebensächlichkeiten der Fokus stets fällt. Das eigentlich Wesentliche wird aber sicher ausgeklammert, kühn voraussetzend, dass der Zuschauer so etwas gar nicht wissen möchte/sollte.
Das Wie der Roels Märchen tut das Übrige. Dieses Verklärende und Getragene des Erzählstils, den die gewiefte Geschichtenerfinderin des Privatsenders hinter den Kulissen bemüht! Unbedingt mit einer Ladung von in Rosa getauchter, schnulziger Romantik. Sehr treffend und toll insg. dargeboten.
Eine der Aussagen des Romans: Alle, die können, versuchen, an den Flüchtlingen zu verdienen, egal wie verschlagen es aussehen mag. Die Fragen der Moral werden erst gar nicht gestellt. Dieser neoliberale Grundgedanke, dass man auch an menschlicher Elend Geld verdient, und davon am besten nicht wenig, ist hier im Laufe der Handlung in mehreren Szenen meisterhaft dargestellt worden.
Klar wurde auch die Tatsache, dass es um 150.000 Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen einer strammen Organisation, eines Chefs mit Geld wie mehrere Ausführungskräfte bedarf, die Wasser, Energie-, Sanitäts- und andere Versorgung täglich zur Verfügung stellen, um so ein komplexes Unterfangen wie ein Fußmarsch von Nordafrika nach Deutschland fertig zu bringen. Und warum? Weil der clevere Boss auf noch mehr Geld spekuliert, von der EU, von den dt Steuerzahlern usw.
C. M Herbst hat kongenial gelesen. Man muss dieses Werk unbedingt hören, sonst entgeht einem viel. So toll lesen kann man selbst nicht.
Fazit: Geniale Groteske zum akuten Thema. Urkomisch, ironisch, Spiegel vors Gesicht der Gesellschaft haltend, unterhaltsam, zum Nachdenken anregend uvm. Unbedingt hören! Ein Hör-Highlight dieses Sommers!
P.S. Wer beim Thema Meiden nicht so ganz auf dem Laufenden ist, liest bei Gelegenheit „Lügen die Medien?“ von Jens Wernicke. Danach wird vieles klarer.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Zum Inhalt:
Europa hat die Außengrenzen dicht gemacht. In Afrika entstehen riesige Flüchtlingslager. Die deutsche Moderatorin Nadeche Hackenbusch macht sich mit einem Fernsehteam auf den Weg ins größte Flüchlingslager der Welt. Sie ist im Fernsehen durch ihre Serie …
Mehr
Zum Inhalt:
Europa hat die Außengrenzen dicht gemacht. In Afrika entstehen riesige Flüchtlingslager. Die deutsche Moderatorin Nadeche Hackenbusch macht sich mit einem Fernsehteam auf den Weg ins größte Flüchlingslager der Welt. Sie ist im Fernsehen durch ihre Serie Engel im Elend bekannt und will nun ein Special drehen.
Lionel ist einer von tausenden Flüchtlingen in Afrika. Als ein deutsches Fernsehteam im Lager eintrifft, sieht er eine Chance, um nach Europa zu gelangen.
Weiterhin ist da noch der Staatssekretär. Er ist in Bayern und beobachtet, wie die Übertragungen aus dem Flüchtlingslager die Einschaltquoten durcheinanderwirbeln.
Was relativ harmlos beginnt, entwickelt sich für Nadeche Hackenbusch zu einer Lebensaufgabe. Daher ist sie entsetzt, als ihr Regisseur plötzlich beschließt, die Sendereihe zu beenden. Sie will die Flüchtlinge aber nicht in ihrem Elend allein lassen und macht sich zusammen mit 150.000 Flüchtlingen zu Fuß auf den Weg nach Deutschland. Kann dieser Marsch Erfolg haben? Sie weiß es nicht? Doch je näher der Tross Deutschland kommt, um so nervöser werden die Politiker....
Meine Meinung:
Ich kenne den ersten Roman des Autors nur von Namen her. Bei seinem neuen Buch Die Hungrigen und die Satten habe ich mich für das Hörbuch entschieden. Dieses wird von Christoph Maria Herbst gelesen.
Mit seinem satirischen Roman trifft Timur Vermes den Nerv der Zeit. Das Thema Flüchtlinge ist seit langem in Europa ein wichtiges und viel diskutiertes Thema. Er zeigt auf, wie ein Privatsender mit einem brisanten Thema Rekordeinschaltquoten erzielt und damit Millionen verdient. Und die Politik redet alles klein, solange die Flüchtlinge weit weg sind.
Auf dem Cover des Hörbuches steht folgender Satz: "Timur Vermes‘ neuer Roman ist eine Gesellschaftssatire, aktuell, radikal, beklemmend und komisch zugleich. DIE HUNGRIGEN UND DIE SATTEN fängt dort an, wo der Spaß aufhört." (Quelle: Bastei Lübbe)
Dieser Satz trifft es wie die Faust aufs Auge.
Was mit Humor beginnt steigert sich zur Dramatik und endet in einem gnadenlosen Inferno.
Das Finale des Buches ist nichts für zartbesaitete Leser.
Mir gefällt das Buch sehr gut. Christoph Maria Herbst ist der perfekte Vorleser für dieses Buch. Durch sein Spiel mit der Stimme verkörpert er aus meiner Sicht die Hauptcharaktere optimal.
Fazit:
Das neue Buch von Timur Vermes hat es in sich. Es ist schwer in ein spezielles Genre einzuordnen, aber auf jeden Fall lesens- bzw. hörenswert. Ich vergebe 5 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Nach "Er ist wieder da" hat sich Timur Vermes an ein neues heikles und unbequemes Thema gemacht: Flüchtlinge. Die Rezension ist genau wie das Buch nicht leicht, denn ich möchte es wertfrei von politischen Überzeugungen halten.
Der Autor selbst hat zu böser und auch …
Mehr
Nach "Er ist wieder da" hat sich Timur Vermes an ein neues heikles und unbequemes Thema gemacht: Flüchtlinge. Die Rezension ist genau wie das Buch nicht leicht, denn ich möchte es wertfrei von politischen Überzeugungen halten.
Der Autor selbst hat zu böser und auch morbider Satire gegriffen. Wer noch mit Kalauern à la "Hitlerjunge Ronaldo" aus "Er ist wieder da" rechnet, wird hier enttäuscht. Allerdings hat der alte Buchtitel einen kleinen Cameoauftritt.
Hier gibt es Spitzen zur momentanen Bildungsfrage, der medialen Unterhaltungsmaschinerie, der Quotenmacherei und der Scheinwelt, in der manche Menschen gerne leben, um nicht über den Tellerrand ihrer Wohlstandsgesellschaft hinausschauen zu müssen.
Als roten Faden führt Nadeche Hackenbusch, ein Möchtegern-TV-Sternchen mit Message eines Privatsenders, durch die Handlung. Sie will mit Glitzerschühchen live und Farbe aus Afrika berichten. Aufgrund hormoneller Manipulation durch ihren schwarzen Assistenten Lionel setzt sich ein Zug von 150.000 Flüchtlingen zu Fuß Richtung Deutschland in Bewegung.
Doch wer denkt, die schaffen das nicht, unterschätzt das durchaus existierende Netzwerk, der Leute, die an Flüchtlingen verdienen und das um jeden Preis.
Mit überzogenen Situationen und Seitenhieben an existierende Personen des öffentlichen Lebens aus Politik, TV und Literatur spitzt sich das Buch zum Ende dramatisch zu und lässt den Leser, sofern er sich durch 450 Seiten gekämpft hat, als Gaffer dastehen.
Das Buch stimmt nachdenklich und das soll es auch. Denn unsere politische Situation ist (vielleicht?) nicht weit von diesem überspitzen Szenario entfernt, in dem die Werte und Normen ins Wanken geraten und die deutsche Geschichte sich wiederholen könnte!?
Aufgrund der Längen vergebe ich 4 von 5 Punkten.
(Außerhalb der Wertung und eher ein Hinweis an den Verlag: Beim ebook ist als Abschluss ein Aufsatz als Bild dargestellt. Dadurch kann man leider die Ränder sehr schlecht und die letzten Zeilen teilweise gar nicht lesen.)
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gar nicht witzig
Deutschland hat endlich eine Flüchtlingsobergrenze. Und durch die Sahara geht nun eine Grenze, die die Flüchtlinge nicht übertreten dürfen. An dieser Grenze befindet sich das weltweit größte Flüchtlingslager mit einer höheren Einwohnerzahl …
Mehr
Gar nicht witzig
Deutschland hat endlich eine Flüchtlingsobergrenze. Und durch die Sahara geht nun eine Grenze, die die Flüchtlinge nicht übertreten dürfen. An dieser Grenze befindet sich das weltweit größte Flüchtlingslager mit einer höheren Einwohnerzahl als Berlin. Und genau dorthin wird nun das TV-Sternchen Nadeche Hackenbusch geschickt. Sie soll vor Ort über die Zustände im Lager berichten. Zeitgleich überlegt sich ein namensloser Flüchtling, wie es wäre einfach nach Deutschland zu gehen. Denn während der Jahre, die er schon gewartet hat, wäre er schon längst angekommen. Er macht sich auf den Weg. Und mit ihm 149.999 andere.
Nachdem mir „Er ist wieder da“ von Timur Vermes nicht so gut gefallen hat, dachte ich, ich versuche es mal mit seinem zweiten Buch. Leider hat mir dieses noch weniger gefallen. Ich wurde kaum unterhalten und zum Lachen war mir auch so gut wie nie. Kopf schütteln, war noch die einzige Reaktion. Zum einen über die Romanfiguren und zum anderen darüber, dass dieses Buch überhaupt existiert. Mir hat die Lektüre keinen Spaß gemacht und ich habe mich gelangweilt.
Dieser Roman umfasst 500 Seiten. Das war definitiv zu viel. Zwischen 250 und 300 Seiten wären perfekt gewesen. Denn so zog es sich und man hatte schon fast selbst das Gefühl zu Fuß von Afrika nach Deutschland zu marschieren. Vieles hätte man weglassen können. Manche ausführlichen Dinge waren aber auch unterhaltsam. Zum Beispiel dem Problem mit den Hinterlassenschaften der Wanderer, wodurch es dann dazukam, dass Dixi-Klos dem Tross folgten.
Der Schreibstil ist einfach und wird durch viele Dialoge aufgelockert. Die Geschichte wird aus wechselnden Perspektiven erzählt. Zwischendurch gibt es immer wieder einen Artikel von Astrid von Roell, der die derzeitige Lage zusammenfasst. Eigentlich hätte man auch nur diese lesen können und hätte auch Bescheid gewusst.
Mich hat dieser Roman enttäuscht und gelangweilt, deshalb vergebe ich nur einen von fünf Sternen.
Weniger
Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Was als ein Kurztrip für ein Fotoshooting beginnt, wird zum größten Medienspektakel Deutschlands und zum kritischsten Moment für die Bundesregierung. Nadesche Hackenbusch, Moderatorin und Liebling der Klatschpresse, fliegt für ein Modeshooting und eine Sonderfolge ihrer …
Mehr
Was als ein Kurztrip für ein Fotoshooting beginnt, wird zum größten Medienspektakel Deutschlands und zum kritischsten Moment für die Bundesregierung. Nadesche Hackenbusch, Moderatorin und Liebling der Klatschpresse, fliegt für ein Modeshooting und eine Sonderfolge ihrer Sendung „Engel im Elend“ in ein Flüchtlingslager am Rande der Sahara. Astrid von Roëll begleitet sie wie immer, von Beginn ihrer Karriere an hat sie Nadesches Aufstieg für EVANGELINE dokumentiert. Doch nachdem Nadesche einige Tage im Lager verbracht hat, läuft der Trip plötzlich aus dem Ruder, denn das Starlet hat die sensationelle Idee, den Menschen zu helfen. Und wo ginge das besser als in Deutschland? Mit 150.000 Flüchtlingen macht sie sich zu Fuß auf den Weg nach Europa - begleitet von einem immer größer werdenden Medientross.
Timur Vermes hat ein Händchen für skurrile Geschichten, wie er in „Er ist wieder da“ bereits eindrucksvoll bewiesen hat. Er macht das Unvorstellbare zum Plot und erzählt dies in einer Weise, dass es plötzlich gar nicht mehr so absurd erscheint, sondern mit jeder Zeile realer wirkt und plötzlich im Rahmen des Vorstellbaren liegt. So beginnt auch „Die Hungrigen und die Satten“ als ironischer Klamauk, der den Boulevard-Journalismus und das Privatfernsehen mit seinen temporären Medienstars köstlich durch den Kakao zieht. Doch irgendwann bekommt der Spaß eine politische Dimension und stellt ernsthafte Fragen, die sich nicht mehr so leicht weglächeln lassen.
Die Geschichte bleibt immer lebendig, vor allem, weil sie aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird und die Figuren herrlich überzeichnet sind: allen voran natürlich Nadesche Hackenbusch, die vor allem durch ihre Naivität und grottiges Englisch besticht; Astrid von Roëll hat nicht nur einen absurden Namen sondern auch eine völlig fehlgeleitete Einschätzung ihres journalistischen Könnens, wobei man sagen muss, dass ihre Artikel so gut den Stil der Revolverblätter imitiert, dass man sich fragt, wie viel Vermes davon gelesen haben muss, um dies so glaubwürdig umzusetzen. Aber auch der Programmchef des Fernsehsenders und der Innenminister haben einen nicht zu leugnenden Unterhaltungswert. Dass viele Figuren eine auffällige Ähnlichkeit mit lebenden Personen haben, ist vermutlich reiner Zufall.
Der Roman lebt aber ganz eindeutig von der Sprache. Mal subtil, mal offen ironisch schildert er die Ereignisse, ohne Rücksicht auf die Figuren, aber diese sind ja auch schonungslos bei der Umsetzung ihrer Vorhaben oder wie Nadesche auf bestechende Weise sagt: „Goes not gives not“. Unzählige kleine Anspielungen -Die Toten Hosen und Lindenberg warten in Berlin auf die Flüchtlinge, um eine Benefizkonzert für sie zu geben - machen es schwer kein breites Grinsen beim Lesen im Gesicht zu tragen.
Doch genau dieses Grinsen bleibt einem im Halse stecken, als der Flüchtlingstross sich langsam der EU-Außengrenze und schließlich Deutschland nähert. Man hatte dies nicht für möglich gehalten und plötzlich wird das Problem doch real und es müssen Maßnahmen ergriffen werden. „Das Volk“ will diese Leute nicht und man muss sie davon abhalten, die Grenze zu übertreten, mit allen verfügbaren Mitteln. Der Spaß ist zu Ende, die Realität hat ihn überholt und was folgt ist das, was man nicht lesen möchte. Aber hier steckt die Stärke eines guten Romans: er konfrontiert uns mit genau den drängendsten Problemen, vor denen wir so gerne auch in die literarischen Phantasiewelten flüchten.
Nach einem solchen Erfolg und sensationellen Roman wie „Er ist wieder da“ hängt die Messlatte hoch, aber Vermes hat diese Hürde ganz locker gemeistert und noch ein Stückchen höher gehängt. Ohne Frage einer der unterhaltsamsten, aber zugleich auch politisch relevantesten Romane des Jahres 2018.
Weniger
Antworten 0 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für