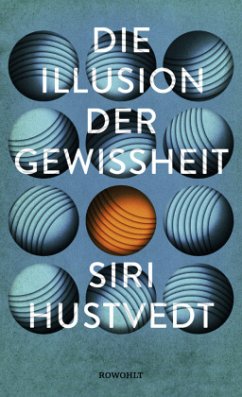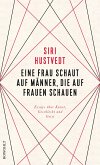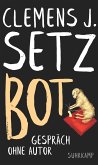Produktdetails
- Verlag: Rowohlt, Hamburg
- Artikelnr. des Verlages: 21138
- 4. Aufl.
- Seitenzahl: 416
- Erscheinungstermin: 11. Mai 2018
- Deutsch
- Abmessung: 210mm x 134mm x 32mm
- Gewicht: 495g
- ISBN-13: 9783498030384
- ISBN-10: 3498030388
- Artikelnr.: 50099962
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Aus eigener Erfahrung: Siri Hustvedt sichtet die Literatur der Hirnforschung
Für Wittgenstein war es durchaus vorstellbar, "dass bei einer Operation mein Schädel sich als leer erwiese". Mit diesem absurd anmutenden Zweifel wollte der Philosoph vielleicht daran erinnern, dass wir es in aller Regel als selbstverständlich hinnehmen, ein Gehirn zu haben, ohne uns dafür auch nur für eine Sekunde Rechenschaft abzulegen. Dass wir ein Gehirn haben, wird uns vor allem dann bewusst, wenn es nicht richtig funktioniert.
Diese Erfahrung musste auch die Schriftstellerin Siri Hustvedt machen, als sie vor einigen Jahren aus heiterem Himmel anfing, vom Hals abwärts zu zittern, und zwar vor allem dann, wenn sie an ihren verstorbenen Vater dachte. Sie schrieb ein lesenswertes Buch über ihr Leiden, in dem sie zwar auch von sich selbst erzählte, vor allem aber ging sie den möglichen neuropsychologischen Ursachen des Zitterns nach und arbeitete sich dazu in die entsprechende neurologische und psychiatrische Fachliteratur von Jean-Martin Charcot bis Antonio Damasio ein.
Seit dem Ausbruch dieser Krankheit, die sie mit Betablockern in Schach hält, hat sich Siri Hustvedt immer weiter in die Neurowissenschaften eingelesen. Sie entwickelte dabei ein wachsendes Unbehagen angesichts der Art und Weise, wie in der akademischen Öffentlichkeit über das Gehirn geredet wird. Die Diagnose, die sie in ihrem Essay "Die Illusion der Gewissheit" (wer mag, wird die Anspielung auf Freud nicht überlesen) stellt, ist völlig richtig: Ständig hört und liest man von kompetenten und manchmal auch weniger kompetenten Hirnarbeitern, wie das Geist-Gehirn funktioniert. Man wird etwa belehrt, dass unser Verhalten durch die evolutionäre Entwicklung unseres Gehirns geprägt wird oder dass die faktischen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen den Unterschied zwischen Mann und Frau weitgehend erklären.
Gegen diese Meinungsgewissheit, die so tut, als ob bis auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich alles geklärt sei, erinnert Hustvedt einmal mehr daran, dass trotz aller Fortschritte auf dem Gebiet der Hirnforschung entscheidende Fragen eben noch nicht geklärt sind, dass bei manchen Fragen noch nicht einmal klar ist, wie sie überhaupt vernünftig zu formulieren wären. Davon ausgehend knöpft sie sich die weitverbreiteten Doktrinen über die "vorprogrammierten" Strukturen im Gehirn vor, die Hypothesen als Fakten verkaufen. Bestsellerautoren wie Steven Pinker oder Daniel Dennett werden ebenso kritisch unter die Lupe genommen wie die Vertreter der Evolutionspsychologie und der Kognitionswissenschaften, die ein Computermodell des Gehirns vertreten und sich in ihrer radikalsten Zuspitzung auf die Erwartung kaprizieren, ihren Geist vom Gehirn auf eine Festplatte zu transferieren.
All diese Kritik ist völlig berechtigt, und besonders lesenswert sind die Abschnitte, in denen sie mit Mary Douglas' Theorie zu Reinheit und Verunreinigung der Künstlichen Intelligenz zu Leibe rückt. Nur: Neu ist das meiste davon nicht. Es fehlt nicht an gewichtigen Einsprüchen gegen den maßlosen Neurohype der letzten fünfundzwanzig Jahre, und auf einige dieser Kritiker bezieht sich Hustvedt auch. Wofür sie sich leider nicht interessiert, sind die praktischen Auswirkungen dieses Hypes auf den Alltag, die von der automatisierten Gesichtserkennung bis zu den Milliardengeschäften mit Neuroenhancement reicht. Von hier aus käme man nämlich zu der Einsicht, dass die Neurowissenschaften sehr wohl politischen und ökonomischen Interessen dienen, und genau diese Zusammenhänge gälte es, besser zu verstehen.
Stattdessen entwickelt die Autorin ihre eigenen Vorstellungen vom Verhältnis zwischen Geist und Gehirn, die an Neuropsychologen wie Oliver Sacks und Antonio Damasio sowie an die Neurophänomenologie Francisco Varelas angelehnt sind, auch wenn sie bei Letzterem dessen buddhistisch inspirierte Infragestellung des wesenhaften Selbst etwas unheimlich findet. Wiederum ist gegen eine solche holistische beziehungsweise die Emotionen integrierende Perspektive erst einmal nichts zu sagen. Doch wenn Hustvedt der von Wolf Singer vorgeschlagenen These, wonach das Gehirn ein Welt schaffendes und Bedeutung generierendes Organ sei, vorhält, dass dies so neu nicht sei, dann trifft das für ihre Ausführungen in noch viel höherem Maße zu, und das macht die Lektüre mitunter etwas mühsam.
Anstatt diese Redundanz der Autorin zum Vorwurf zu machen, ist es wohl erkenntnisfördernder, hierin ein Symptom zu sehen. Über das Gehirn und seine Relevanz für unser Menschsein ist in den letzten Dekaden so viel geschrieben worden, dass es unter den gegenwärtigen paradigmatischen Grundannahmen nicht mehr viel Neues hinzuzufügen gibt, auch nicht für eine so gewissenhafte Autorin wie Siri Hustvedt. Wenn aber das mehr oder weniger Bekannte nur noch einmal aufbereitet wird, folgt daraus, dass es vorläufig nicht mehr allzu ergiebig ist, sich mit diesem Gegenstand weiter zu befassen. Erkenntnisgegenstände haben ihre eigene Historizität: Sie steigen auf, haben ihre Konjunktur, und irgendwann beginnen sie wieder zu verblassen. Es deutet viel darauf hin, dass dem Gehirn - falls nicht den Neurowissenschaften ein spektakulärer Coup gelingt, was nicht zu erwarten, aber natürlich nie auszuschließen ist - gegenwärtig genau das passiert.
Damit keine Missverständnisse entstehen: Das heißt nicht, dass sich nicht auch weiterhin viele Menschen professionell mit dem Gehirn befassen werden. Das heißt auch nicht, dass nicht weiterhin sehr viel Geld in die Neurowissenschaften gesteckt wird, um die zur Genüge vorhandenen offenen Fragen weiter zu erforschen. Das heißt nur, dass die Fokussierung auf das Gehirn als den Ort, der quasi ausschließlich über Wohl und Wehe der conditio humana entscheidet, sich selbst erledigt. Der lange Sommer des Gehirns scheint erst einmal an ein Ende zu kommen, und das ist auch gut so.
MICHAEL HAGNER
Siri Hustvedt: "Die Illusion der Gewissheit".
Aus dem Englischen von Bettina Seifried. Rowohlt Verlag, Reinbek 2018. 416 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Als Essayistin ist Siri Hustvedt unvergleichlich. The Sunday Telegraph