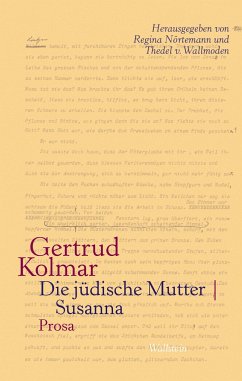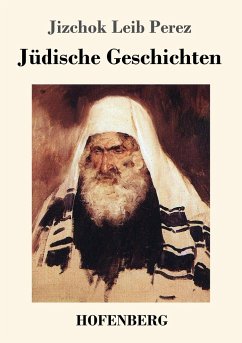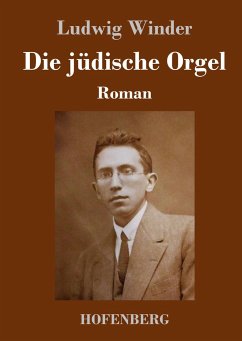Die jüdische Mutter
Roman
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
9,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die früh verwitwete Martha Wolg, Tochter einer aus Westposen nach Berlin übersiedelten assimilierten jüdischen Familie, lebt allein mit ihrem Kind Ursula. Es ist das Berlin der späten zwanziger Jahre.Ihren Lebensunterhalt verdient Martha als Fotografin. Als sie eines Abends in ihre Wohnung zurückkehrt, ist die Tochter verschwunden. Die bis in die Nacht andauernde Suche bleibt erfolglos, doch sie erhält einen Hinweis auf einen Motorradfahrer, der das Kind zu sich gelockt haben soll. In einer verwahrlosten Gartenlaube findet Martha das mißbrauchte und schwer mißhandelte Kind.Unfähig, da...
Die früh verwitwete Martha Wolg, Tochter einer aus Westposen nach Berlin übersiedelten assimilierten jüdischen Familie, lebt allein mit ihrem Kind Ursula. Es ist das Berlin der späten zwanziger Jahre.Ihren Lebensunterhalt verdient Martha als Fotografin. Als sie eines Abends in ihre Wohnung zurückkehrt, ist die Tochter verschwunden. Die bis in die Nacht andauernde Suche bleibt erfolglos, doch sie erhält einen Hinweis auf einen Motorradfahrer, der das Kind zu sich gelockt haben soll. In einer verwahrlosten Gartenlaube findet Martha das mißbrauchte und schwer mißhandelte Kind.Unfähig, das Leiden ihres Kindes mitanzusehen, tötet sie es noch im Krankenhaus mit einer Überdosis Schlafmittel.In den folgenden Jahren bemüht sich Martha verzweifelt darum, den - wie sie es sieht - Mörder ihres Kindes zu finden. Ihre Umgebung und die Beziehung zu einem Mann sind nur noch auf dieses Ziel gerichtet. Das schließliche Scheitern ist unausweichlich.Im Nachlaß Gertrud Kolmars fand sich der umfangreiche Prosatext, der 1930/31 entstand und 1965 erstmals gedruckt wurde. In vielen Details spiegelt er autobiographische Erfahrungen Kolmars im Berlin der späten zwanziger Jahre. Der stärker werdende Antisemitismus und die gleichzeitige Notwendigkeit, sich mit der eigenen jüdischen Identität auseinanderzusetzen, liefern den Hintergrund für eine Erzählung von großer Eindringlichkeit.Im Medium einer fast expressionistischen Stilgeste werden die tiefen emotionalen Bindungen und ihr schmerzlicher Verlust beklemmend eindrücklich dargestellt. Der Text entwickelt einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann.Zur EditionDie Neuausgabe der »Jüdischen Mutter« folgt in ihrer Textgestalt erstmals vollständig dem Typoskript Gertrud Kolmars, das sich im Deutschen Literaturarchiv in Marbach befindet. Korrekturen und Varianten des Manuskripts werden im Anhang verzeichnet.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.