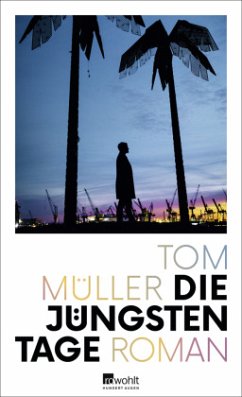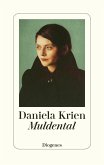"Wie rettet man den Sturm der Jugend über die Zeit? Tom Müller kann davon eindrucksvoll erzählen." (Bov Bjerg)
Jonathan Buck steht am Bahnsteig nach Berlin, er wartet auf den Zug. Die Mutter seines Jugendfreundes Strippe will ihn dringend sprechen, und es gibt keine Ausflucht mehr. Denn Strippe ist tot, und seine Mutter will von Jonathan hören, was war und was jetzt werden soll. Das Einzige, was Jonathan will, ist neben Elena im Bett liegen, d'Annunzio lesen, rauchen. Kalte Tomatensuppe löffeln, sich an früher erinnern, an die Berliner Nachwende-Jugend, als alles möglich schien. An Strippes Seite.
Vor dreißig Jahren, im Vakuum der Wendejahre, haben sie Sinnlichkeit gesucht und neue Idole. Sie wollten Helden sein im Aufstand der Gefühle. Strippes Tod zwingt Jonathan Gericht zu halten, über sich, die Zeit und seine Träume.
Tom Müller erzählt die Geschichte einer Freundschaft, die immer an die Grenzen ging, erzählt von Aufbruch und Übermut, die kein Maß kannten. "Die jüngsten Tage" ist cool und voller Emphase: eine Reise zwischen Hamburg und Berlin, Kindheitsabenteuern und Gegenwartseskapade, italienischen Dichtern und deutschen Zügen. Mehr Schmerz, mehr Witz, mehr Aufruhr war selten. Ein herausragendes Debüt.
Jonathan Buck steht am Bahnsteig nach Berlin, er wartet auf den Zug. Die Mutter seines Jugendfreundes Strippe will ihn dringend sprechen, und es gibt keine Ausflucht mehr. Denn Strippe ist tot, und seine Mutter will von Jonathan hören, was war und was jetzt werden soll. Das Einzige, was Jonathan will, ist neben Elena im Bett liegen, d'Annunzio lesen, rauchen. Kalte Tomatensuppe löffeln, sich an früher erinnern, an die Berliner Nachwende-Jugend, als alles möglich schien. An Strippes Seite.
Vor dreißig Jahren, im Vakuum der Wendejahre, haben sie Sinnlichkeit gesucht und neue Idole. Sie wollten Helden sein im Aufstand der Gefühle. Strippes Tod zwingt Jonathan Gericht zu halten, über sich, die Zeit und seine Träume.
Tom Müller erzählt die Geschichte einer Freundschaft, die immer an die Grenzen ging, erzählt von Aufbruch und Übermut, die kein Maß kannten. "Die jüngsten Tage" ist cool und voller Emphase: eine Reise zwischen Hamburg und Berlin, Kindheitsabenteuern und Gegenwartseskapade, italienischen Dichtern und deutschen Zügen. Mehr Schmerz, mehr Witz, mehr Aufruhr war selten. Ein herausragendes Debüt.

Rauschen, Nebel und ein Licht in der Ferne. In diesem Roman herrscht das Chaos und das ist gut so.
© BÜCHERmagazin, Katharina Manzke

Sieben literarische Debüts stehen auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Die beiden besten sind nicht darunter
Als am Dienstag die zwanzig Romane bekannt gegeben wurden, die in diesem Jahr auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis stehen, und sich unter diesen Romanen gleich sieben literarische Debüts befanden, war dies eine völlig überraschende Nachricht. Sind die Jungen dabei, die Alten zu besiegen? Sind die neuen in diesem Jahr wirklich interessanter und besser als jene Autorinnen und Autoren, die bereits auf ein Werk zurückblicken? Oder handelt es sich um eine bewusste Maßnahme der Jury zur Förderung junger Literatur?
Wer auf der Liste steht, muss sich auch an denen messen lassen, die es nicht auf diese geschafft haben: "Das flüssige Land", der Debütroman der Österreicherin Raphaela Edelbauer über einen Ort, unter dem sich ein riesiger Hohlraum befindet, der die Bewohner auf merkwürdige Weise zu bestimmen scheint, über den aber niemand sprechen will, ist dabei. Steffen Kopetzky mit "Propaganda", seiner Rekonstruktion der Schlacht im Hürtgenwald, die von einem amerikanischen Soldaten in der Abteilung für psychologische Kriegsführung erzählt, ist es aber nicht. Miku Sophie Kühmels Debüt "Kintsugi", benannt nach dem japanischen Kunsthandwerk, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu kitten, weil Schönheit nicht in der Perfektion zu finden ist, sondern im guten Umgang mit Brüchen und Versehrtheiten, steht auf der Liste. Sibylle Bergs "GRM" über den Brexit, den Überwachungsstaat, die Gentrifizierung und das zerfallende Europa, für viele schon seit dem Frühjahr der Roman des Jahres, fehlt. Kann das wirklich sein?
Kann es nicht. Nicht jedenfalls, wenn man "Kintsugi" zu lesen beginnt und vom ersten Satz an mit so vielen Adjektiven konfrontiert ist, dass man überhaupt nur noch Adjektive sieht: "Als sie das Haus erreichen, ist das Licht schon senfgelb und die Schatten sind lang", lautet der erste harmlose Satz. Der "Tag" ist "scheu"; es "dämmert früh"; der Baum ist "hohl"; das Haus steht "schwarz geschindelt da, schmucklos und vernarbt". Die Ruhe "schmiegt sich kühl an ihre Ohren". Die Dunkelheit ist "vertraut"; die Teekanne "faustgroß" und "gusseisern". Warum darf sie nicht einfach eine Teekanne sein? Die Betten werden mit "frischer weißer" Baumwolle bezogen, "dick und fluffig wie zwei satte Wolken"; eine "glatte, kühle Weichheit". Alles ist erwartbar: "Was er vom Himmel erahnen kann, ist dunstig-blau, nur eine schmale, längliche Wolke wird von der Sonne noch im Abgang über die Schulter rot angeleuchtet." Und jedes weitere Adjektiv ist nur ein Hilfsmittel, um das Erzählte literaturhaft erscheinen zu lassen.
Miku Sophie Kühmel, die 1992 in Gotha geboren wurde und in Berlin und New York studiert hat, erzählt von einer Viererkonstellation in einem Wochenendhaus aus diesen vier Perspektiven. Es ist eine interessante Versuchsanordnung, die Sprache hält einen aber nicht. Vor allem dann nicht, wenn man gerade den Roman "Pixeltänzer" gelesen hat, der gar nicht auf der Liste steht, die dort stehenden Debüts aber überstrahlt. Denn alles an diesem Buch ist überraschend. Die Autorin, 1982 geboren, heißt Berit Glanz, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neuere Skandinavische Literaturen der Uni Greifswald, besitzt auf Twitter eine große Followerschaft. Sie fragt: Wie geschichtsvergessen ist unsere Gegenwart? Ist die Geschichtsvergessenheit unser Verhängnis?
Sie führt uns mit beeindruckender Souveränität in die Tech-Welt der Start-ups und der Programmierer, in der "Backend-Developer an ihren Trail-Mix-Beuteln hängen, als müssten sie die letzten Höhenmeter der Eiger-Nordwand überwinden". Sie findet für ihre Protagonistin ein Hobby: Beta bastelt Modelle von Tieren und druckt sie mit ihrem 3D-Drucker aus. Sie gibt ihr eine Mission: "Mein erklärtes Ziel für diesen Sommer ist es, in allen Eisdielen innerhalb des Berliner Rings eine Kugel Erdbeereis zu essen" - was die Entwickler in ihrer Umgebung sofort anfixt, weil es keinen Algorithmus gibt, der den kürzesten Weg für den aufeinanderfolgenden Besuch mehrerer Orte berechnen kann. Das Ganze nennt sich das Problem des Handlungsreisenden.
Und sie erfindet für ihren Roman eine Weckruf-App: "Dawntastic", die von der Annahme ausgeht, dass man morgens schneller wach ist, wenn der Tag mit einem Gespräch startet. Regelmäßig lässt sich Beta von "Dawntastic" wecken und erhält zur eingestellten Zeit einen Anruf von einer fremden Person, die irgendwo auf der Welt gerade wach ist. Eines Morgens ist das ein Mann, der sich Toboggan nennt. Sein Profilbild zeigt eine Figur mit Maske, er hat eine warme Stimme und meldet sich aus Palo Alto. Sie tauschen sich über den Todessound des Atari-Spiels "Pitfall" aus, und bevor sie wieder auflegt, fragt Beta: "Was ist das auf deinem Profilbild?" - "Es hat mit meinem Nutzernamen zu tun", sagt Toboggan. "Vielleicht findest du es heraus?"
So beginnt eine Spurensuche, die Beta aus ihrer absoluten Gegenwartswelt in die Vergangenheit führt. Es beginnt mit den Koordinaten einer Adresse in der Potsdamer Straße 134 a in Berlin, wo in den zwanziger Jahren die expressionistische Zeitschrift "Der Sturm" von Herwarth Walden herausgegeben wurde. Der Name der Zeitschrift gefällt Beta nicht, also recherchiert sie skeptisch weiter. Immer wieder hinterlässt Toboggan Nachrichten oder versteckt Texte im Quellcode von Betas Blog. Es sind biographische Bruchstücke des avantgardistischen Künstlerpaares Walter Holdt und Lavinia Schulz, einer Tänzerin, die in selbst entworfenen Ganzkörperkostümen auftrat, an der vorsätzlichen Unverwertbarkeit ihrer Kunst, die nicht Ware sein sollte, aber tragisch scheiterte.
In der Begegnung mit dieser Vergangenheit rüstet sich Beta gegen den Verwertbarkeitswahn und die Überwachungsmechanismen ihrer Gegenwart. Die Geschichte verändert sie, stiftet sie zu einem Ausbruchsversuch an: Die "Pixel" des digitalen Zeitalters und die "Tänzer" der Weimarer Republik führt Berit Glanz zusammen in einer Geste der Verweigerung. Und man kann über diese Zusammenführung und überhaupt über diesen Roman einfach nur staunen.
Tom Müller, der ebenfalls nicht auf der Liste steht, will das auch: Vergangenheit in einer erzählten Gegenwart aufleben lassen. "Die jüngsten Tage" heißt der erste Roman des 1982 in Berlin-Friedrichshain geborenen Autors, der seit diesem Jahr Leiter des Tropen-Verlags in Berlin ist. Wie mühelos er von der Lektoren- und Verlegerrolle in die des Autors wechselt, ist schon besonders. Jonathan Buck heißt sein Ich-Erzähler, der zu Beginn des Romans am Bahnsteig nach Berlin steht und auf den Zug wartet. Sein Freund ist tot. Sein bester Freund, Stippe, mit dem er schon in der DDR-Kita war, mit dem er Zigaretten klaute, die Zeit unmittelbar nach der Wende durchlebte. Ein Grenzgänger, ein Aufgewühlter in einer unsicheren Zeit, wie er selbst, auf der Suche nach Idolen. Stippes Mutter will von Jonathan wissen, was war. Zu ihr soll er fahren, doch weigert sich alles in ihm. Lieber bleibt er bei seiner Freundin Elena, lässt die Erinnerungen an Stippe wiederaufleben und liest Gabriele D'Annunzio.
Denn der italienische Dichter, der 1919 die Eroberung der Stadt Fiume anführte, steht in "Die jüngsten Tage" für einen Aufbruch, den Tom Müller mit dem Aufbruch der Wendejahre der beiden Freunde in Deutschland überblenden will. Nur kommen sie nicht zusammen, was vor allem daran liegt, dass der Autor von der Wende wenig, von D'Annunzio aber viel erzählt. Dass er seiner Begeisterung für D'Annunzio erliegt, wenn der Mann mit der Augenklappe und dem kahlen Kopf immer wieder um die Ecke kommt, am Ende sogar persönlich auftritt und ein paar Befehle gibt.
"Ich schmiede keine Pläne, ich glühe", lautet das D'Annunzio-Zitat, das Tom Müller seinem Roman voranstellt. Auch Stippe hat diese Worte verwendet, als er damals, in ihrem persönlichen Ausnahmezustand, aus Gründen vor allem der Distinktion D'Annunzio spielte und sie ihre Gemeinschaft beschworen. Sie wollten glühen. Nun, wo der Freund tot ist, ist Jonathan hin- und hergerissen, kann sein Glühen für den italienischen Dichter nicht ganz aufgeben, will mit ihm aber auch ins Gericht gehen. Er habe seine Seele an Mussolini verkauft, wirft er ihm vor. Doch geht daraus nicht viel mehr hervor als ein unentschiedener Abschied von der Distinktion.
Die Entschiedenheit, Klarheit, Härte und Sicherheit im Ton in "Taxi", dem ersten Roman von Cemile Sahin, ist dagegen eine Wucht. Sahin, 1990 in Wiesbaden geboren, studierte Bildende Kunst am Saint Martins College in London und an der UdK in Berlin und wurde gerade als "ars viva"-Preisträgerin 2020 ausgezeichnet. Wir wissen nicht genau, wo dieser Roman, der auf der Longlist fehlt, spielt. Wir wissen nur, dass er nicht in Deutschland spielt, weil aus Deutschland später jemand zurückkommt, der gehofft hatte, dort ein besseres Leben verbringen zu können. Überhaupt hat die ganze Erzählung wenig Koordinaten und beansprucht damit eine dunkle Universalität.
Eine Mutter entdeckt einen jungen Mann, Mitte dreißig, der ihrem Sohn ähnelt, den sie in einem Krieg verloren hat. Sie geht ihm wochenlang nach, beobachtet ihn, bis sie irgendwann auf ihn zukommt und sagt: "Ich möchte, dass du wieder nach Hause kommst." Sie zieht Geld aus ihrer Tasche, mehrere tausend Euro, und bietet ihm einen Deal an: Er soll die Rolle ihres Sohnes spielen in einer Erzählung im Stil einer amerikanischen Serie. Die Regie übernimmt sie, die Mutter, Rosa Kaplan. Die Behörden haben ihr gesagt, ihr Sohn, Polat Kaplan, wäre nach einer Bombenexplosion, die sich gegen 5.30 Uhr am Morgen des 1.1.2007 ereignete, nicht wiederzufinden. Sie beerdigten ihn in einem leeren Sarg. Aber über einen Sarg, der leer war, konnte die Mutter nicht weinen. Es war ja nichts drin. Ihr Sohn musste am Leben sein. Und weil er nicht zurückkehrte, suchte sie sich einen, der ihn zumindest spielte. Einen, der tatsächlich sein Leben aufgab und ihr Sohn wurde. Er beginnt, Polat Kaplan zu sein, bald besteht er darauf, klagt es ein.
Obwohl es vermutlich kein richtiges Leben im falschen gibt, besteht möglicherweise die Chance, ein gutes Leben in einem schlechten Leben zu finden, sagt Cemile Sahin. Von dieser Möglichkeit erzählt "Taxi". Doch blitzt die Möglichkeit nur kurz auf. Die Verstrickungen von Wirklichkeit und Fiktion sind heillos. Sie machen den Sohn, der nicht der Sohn ist und es doch sein will, zum Mörder und anschließend zum Opfer von Folterungen. Sie gewähren kein Zurück. Eigentlich will Rosa Kaplan bloß die Hoheit über ihre Geschichte wiedererlangen, die die Obrigkeit ihr genommen hat. Cemile Sahin erzählt, was es bedeutet, wenn eine Mutter ihr Kind verliert, und führt unerbittlich vor, was der Krieg mit uns anrichten kann. Sie erzählt es sehr gut. Die beiden besten Debüts des Herbstes stehen nicht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.
JULIA ENCKE
Berit Glanz: "Pixeltänzer", Roman, Schöffling, 256 Seiten, 20 Euro. Miku Sophie Kühmel: "Kintsugi", Roman, S. Fischer, 304 Seiten, 21 Euro. Tom Müller: "Die jüngsten Tage", Roman, Rowohlt, 240 Seiten, 22 Euro. Cemile Sahin: "Taxi", Roman, Korbinian, 220 Seiten, 20 Euro (erscheint am 1. Oktober, vorzubestellen unter korbinian-verlag.de).
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Tom Müller hat eine beeindruckende Sprache gefunden für das existenzielle Verlieren und das existenzielle Verlieben ... ein literarisch versiertes Buch über den Schmerz und über eine schier endlose Traurigkeit. Martin Becker Deutschlandfunk "Büchermarkt" 20191025