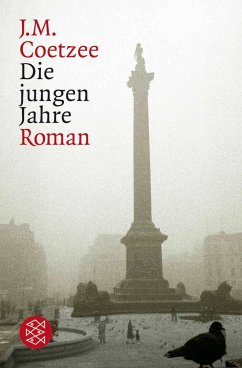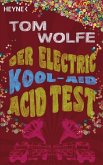In "Die jungen Jahre" setzt der große südafrikanische Romancier J.M. Coetzee seine mit "Der Junge" begonne Autobiographie fort. "Im richtigen Leben, so scheint es, kann er nur eins richtig: unglücklich sein", lautet das Fazit den jungen Studenten. Anfang der 60er Jahre kann er der Enge und politischen Situation Südafrikas in seine Traumstadt entrinnen: London. Doch obwohl er als Mathematiker rasch eine Stelle als Programmierer bei IBM findet, gelingt es ihm nicht, heimisch zu werden. Er fühlt sich als Außenseiter und Büromensch, während er sich insgeheim danach sehnt, daß der Dichter in ihm zum Ausbruch kommt oder wenigstens eine schöne Frau ihm ihre Liebe schenkt und ihn so zu unvergänglichen Versen inspiriert.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Lehrjahre am Tintenfaß: J. M. Coetzees Londoner Zeit / Von Felicitas von Lovenberg
Wie wird man Schriftsteller? Wie muß man leben, wen darf man lieben, als was soll man arbeiten, bis künftiger Ruhm die Rechnungen bezahlt? Wird man zum Literaten geboren, oder kann man sich selbst dazu erziehen? Diese Fragen bewegen John ungemein; eigentlich sind sie das einzige, was ihn überhaupt zu bewegen vermag. Denn im Grunde lassen Begegnungen, Gefühle, Umstände ihn völlig kalt. Das ist auch seine größte Sorge: sein Naturell. Was, wenn es dem eines wahren Schriftstellers einfach nicht entspricht? "Was stimmt mit ihm nicht? Wenn die Antwort lautet, daß es sein Naturell ist, wozu ist ein solches Naturell gut? Warum sollte er nicht sein Naturell ändern?"
Wie sich jedoch herausstellt, ist er dieser schwierigsten aller Aufgaben nicht gewachsen. Sein Naturell vermag der Protagonist in "Die jungen Jahre", dem zweiten Band von Coetzees romanhafter Autobiographie, nicht zu ändern. Was sich verändert, ist allein der Horizont seiner Erfahrungen. Der treffendere Originaltitel lautet "Youth", Jugend, was eher einen Zustand als einen Zeitraum meint. Wie schon zuvor in "Der Junge" (1998) nimmt Coetzee erneut den größtmöglichen Abstand zu seiner Figur ein, die dem Leser als südafrikanischer Burensohn, der nach dem Studium der Mathematik und Literatur in Kapstadt 1962 nach London geht, nur notdürftig verschleiert als der zweiundzwanzigjährige Autor selbst entgegentritt. Vordergründig handelt das Buch vom England der frühen Sechziger, von der Büroarbeit bei IBM, von verpaßten Gelegenheiten und unzureichenden Beziehungen. Doch eigentlich geht es bei Coetzees ereignisarmer und doch faszinierender Alltagsbeschreibung und ihrer chronologischen Berichtstreue einzig um einen, der auszog, das Schreiben zu lernen.
Diesen Blick zurück trübt keine Sentimentalität. In der dritten Person schreibt Coetzee über den jungen Mann, den eine Frau erst nach einigen Seiten beiläufig vorstellt: "Ich fahre John nach Hause." Hallo John, nett, Sie kennenzulernen: Nein, so einfach macht Coetzee es uns nicht. John heißt nur für andere John: für die Mutter, die ihn zu Hause in Südafrika mit Fürsorge schier erdrückt hat und ihm nun jede Woche einen Brief schreibt; für die Mädchen, mit denen er schläft, wenn sie es zulassen; für die Kollegen bei IBM, wo er als Computerprogrammierer eine eintönige Arbeit findet. Für Coetzee, für uns bleibt es bei "er".
Er ist ein Asket, der sich die ganze Woche über von einem Topf dünner Suppe ernährt, die er sich jeden Sonntag kocht - "eine Diät, mit der Rousseau einverstanden wäre, oder Plato". Aber ist er nicht mal eitel genug, um dieses Bild von sich zu kultivieren. Er will um keinen Preis auffallen, auch nicht durch Exzentrizität. Statt durch Revolte will er durch anständigen, biederen Trott beweisen, "daß jeder Mensch eine Insel ist; daß man keine Eltern braucht". Währenddessen wartet er auf seine Initiation, auf jenes Ereignis, daß aus dem Jungen endlich einen Mann machen wird. Mit der sexuellen Erfahrung, das hat er schon festgestellt, ändert sich nichts: ein körperliches Bedürfnis wie andere auch. Daß Frauen damit häufig Gefühle verbinden, ist ihm lästig. Seinen kindlichen Glauben an die grundsätzliche, alles verändernde Kraft der Liebe jedoch vermag dies nicht zu erschüttern: "Befreien wird ihn, wenn es soweit ist, die Liebe. Die Geliebte, die ihm Bestimmte, wird sofort das wunderliche Äußere, das er zur Schau trägt, durchschauen und das Feuer sehen, das in ihm brennt."
Das Feuer, das einstweilen höchstens als Flämmchen in ihm flackert, braucht Poesie, um sich auszubreiten. Johns Vorbilder sind vor allem die Dichter T. S. Eliot und Ezra Pound, doch je mehr er liest, desto entmutigter ist er von seinen eigenen literarischen Versuchen. Er führt Tagebuch, aber erlebt wenig; er schreibt Sonette nach dem Vorbild Rilkes - sie bewegen nicht einmal sein eigenes Herz. Er sitzt er an einer Dissertation über die Romane von Ford Madox Ford, hat sich aber damit abgefunden, daß er "nichts Neues über Ford zu sagen" hat. Nur einmal zitiert er ein eigenes Gedicht - und fügt hinzu, daß seine Lyrikversuche generell "substanzlos" seien. Da hat man die Vermutung, daß es sich bei solchen Bemerkungen um übertriebene Bescheidenheit handeln könnte, längst aufgegeben.
Seine Unfähigkeit in Beziehungsdingen erklärt er sich an guten Tagen mit einem künstlerischen Bedürfnis nach innerer Einsamkeit. An anderen quält ihn die Vorstellung, daß er allein bleiben wird: "Was ist wirklich - das Glücklichsein, das Unglücklichsein oder etwas dazwischen?" Doch zum Glück fehlt ihm offenbar die Begabung. Statt sich zu freuen, daß er seine Ziele erreicht hat - er ist Südafrika entronnen, er ist in London, er hat eine Arbeit -, fühlt er sich im Innersten bedroht: Der Alltag bei IBM ist im Begriff, "ihn in einen Zombie zu verwandeln". Den Leser läßt das kalt: Zu zombiehaft erscheint ihm John seit Beginn ihrer Bekanntschaft.
Einzig Routine gibt ihm Sicherheit, und so tut er alles, um sie zu schaffen. Unter der Woche arbeitet er, am Samstag geht er in Buchhandlungen, Galerien, Museen, Kinos. Am Sonntag liest er den "Observer" und macht einen Spaziergang. Doch an den Abenden "verschlingt ihn die Einsamkeit, die er sonst im Zaum halten kann". Der Plan, richtig zu leben, um sich dann ernsthaft ans Schreiben zu machen, schlägt immer wieder fehl. Fast scheint es, als habe er Angst davor, daß seine Erwartungen sich je erfüllen könnten. Bei jeder Frau, der er begegnet, fragt er sich, ob es die Richtige ist - und hofft zugleich, sie möge es nicht sein: Die meisten sind ihm zu häßlich. Die Bücher, die er liest, beeindrucken ihn, aber nicht genug, um mit einem Leben aus zweiter Hand zufrieden zu sein. Sie reißen ihn allerdings auch nicht aus seiner Apathie. Er steckt in der Sackgasse, doch fehlt ihm die Kraft oder der Wille, umzukehren. So schwelgt er weiterhin in Einsamkeit und Misanthropie.
Coetzee sucht keine Entschuldigungen für seinen kraftlosen Held, macht keine Ausflüchte. Er scheint selbst nicht zu wissen, welchen Grad der Verzweiflung dieser erreichen muß, bevor er sich aus seiner Starre löst. Wenn es stimmt, daß Literatur ihre Leser im Guten wie im Schlechten beeinflussen kann, liest John die falschen Bücher. Und auch seine autodidaktischen Versuche schlagen fehl: Die monotone Büroarbeit macht ihn jedenfalls nicht zu einem zweiten Franz Kafka oder Wallace Stevens. Grenzerfahrungen mit Drogen oder Alkohol sind ihm unheimlich: "Sind Erschöpfung und Elend nicht in der Lage, dasselbe zu leisten?" Johns Wahnsinn ist von der stillen, diskreten Sorte. Doch immerhin fürchtet er, seinen "poetischen Impuls" durch die Eintönigkeit zu verlieren.
Coetzee schildert die Leiden des jungen John ausführlich, mit bitterem, humorlosem Sarkasmus. Obwohl er nichts zu beschönigen, keine Niederlage auszulassen scheint, entsteht nie der Eindruck, daß ihm diese Selbsterniedrigung schwerfällt oder daß die Erinnerung an manche Episoden, etwa an die Abtreibung eines Kinds, das John mit einer seiner Bekanntschaften gezeugt hat, ihn schmerzt. Dem Autor liegt nicht daran, Erfahrungen existentieller zu schildern, als sie damals offenbar waren. Er ist einfach froh, ihnen entkommen zu sein.
Endlich, nach vielen quälenden Monaten, erlebt John so etwas wie eine Katharsis. Sie erreicht ihn an einem Frühsommertag in der Hampstead Heath, wo er in einen Schlaf sinkt, "in dem das Bewußtsein nicht schwindet, sondern über ihm schwebt. Das ist ein Zustand, der ihm bisher unbekannt gewesen ist: bis in sein Blut hinein scheint er das unablässige Kreisen der Erde zu spüren. Das Herz wird ihm weit. Endlich!, denkt er. Endlich ist er da, der Moment der ekstatischen Einheit mit dem All!" Als er aufsteht, erfüllt ihn die Gewißheit, "daß er auf diese Erde gehört".
Die Zuversicht hält nicht lange vor. Coetzees unbarmherzige Roßkur für den Schriftstellernovizen heißt scheitern, scheitern, scheitern. Sein eigener Triumph liegt in seiner unmittelbar ergreifenden Plausibilität und Authentizität dieses Buchs, in der "Aura der Wahrheit", wie John es jugendlich hochtrabend nennt. Dafür zieht er - von dem man allzuoft vergißt, daß es Coetzee selbst ist, der hier spricht - sich zurück auf die Erfahrung: "Der Künstler muß jede Erfahrung auskosten, von der edelsten bis zur erbärmlichsten." So gelingt es ihm, sich und uns seine Zeit in London als "nichts weiter als eine Etappe auf seiner Reise in die Tiefe" zu verkaufen. Kaum ausgesprochen, wird diese Rechtfertigung wieder zurückgenommen. Denn wichtiger als Ansehen ist schonungslose Ehrlichkeit, im Leben wie in der Literatur - Coetzee zufolge "die einfachste Sache der Welt".
"Dichten heißt nicht, seiner Gefühlwelt freien Lauf zu lassen, wohl aber: sich von seinen Gefühlen befreien", sagt T. S. Eliot. Was aber, wenn man gar keine Gefühle hat? Genügt es da zu wissen, daß auch Rimbaud und Baudelaire keine warmherzigen Menschen waren? Bei Coetzee erscheint Kunst nicht als Kompensation, sondern als Tatsache, genauso wie Charakter. Was bleibt von seinem Porträt des Künstlers als jungem Mann, ist neben der gewohnten stilistischen Brillanz die große Ehrlichkeit, gleichermaßen beeindruckend wie abstoßend, und die erstaunlich klare literarische Entwicklungslinie, die ihn in London von Eliot über Ford bis zu Beckett führt, und die der Leser in Gedanken weiterzieht zu Coetzees Romanen "Zeit und Leben des Michael K.", "Warten auf die Barbaren" und, vor allem, zu "Schande". So hat Coetzee die eigene Zeit der Starre vierzig Jahre später in ein beeindruckendes Memoir verwandelt.
J. M. Coetzee: "Die jungen Jahre". Aus dem Englischen übersetzt von Reinhild Böhnke. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2002. 220 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main