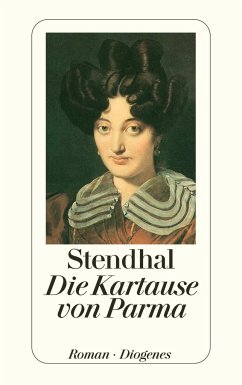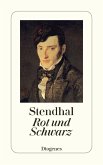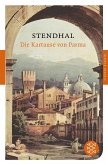Fabrizio del Dongo, einem jungen, reichen und ein wenig leichtfertigen Adeligen, öffnen sich Türen und Herzen. Dennoch leidet er an seinem Unvermögen, das Leben zu meistern. Zwar kann er in der Verborgenheit einer verbotenen Liebe im Widerspruch zu seinem Amt als kirchlicher Würdenträger zeitweise das Glück genießen. Doch mit einer unbedachten Handlung macht er alles zunichte.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hier kocht jeder sein Trieb- und Machtsüppchen: Stendhals "Kartause von Parma", neu und grandios übersetzt / Von Urs Widmer
Es gibt Leser, Paul Valéry zum Beispiel, die Stendhals "Kartause von Parma" für das hinreißendste Buch der Weltliteratur überhaupt halten, und ich neige zuweilen auch dieser Ansicht zu. Sie ist auf jeden Fall eines der Wunder, die sich auch im Schreibleben bedeutender Autoren - wenn überhaupt je - nur einmal ereignen. Ein Geschenk der Götter, und nachher weiß auch der Autor nicht genau, wie das eigentlich gegangen ist.
Stendhal, der Henri Beyle hieß und länger in Italien als in Frankreich lebte, hat die "Kartause von Parma" 1838 in weniger als zwei Monaten einem Sekretär diktiert, in einer Mischung aus höchster Konzentration und einer frei improvisierenden Lockerheit. An manchen Tagen schaffte er vierzig Seiten, und am Ende waren es (in der deutschen Übersetzung) sechshundertvierundfünfzig. Macht mehr als zwölf pro Tag - Druckseiten! -, auch an Sonn- und Feiertagen. Auch wenn er gewiss lange vorher im Kopf geschrieben hatte und auch vielfältige Notizen verwendete: Die Entstehung der "Kartause" war ein Rausch, bei dem Stendhal das Kunststück gelang, seine vor Hitze glühende Handlung in einer Sprache zu erzählen, die knapp, lakonisch, witzig und leicht ist. "Natürlich", so umschrieb Stendhal sein Sprachideal. Als stünde der Erzähler neben uns und erzählte uns, beiläufig und erregt, etwas, was wir nur glauben, weil er es erzählt. Aber wir glauben es, jedes Wort, und gern.
Die "Kartause von Parma" stellt an Vielfalt und Heftigkeit der Handlung so ziemlich jedes andere Buch in den Schatten. Gift und Dolch, jede Menge Morde, Intrigen, Willkür, Machtmissbrauch, Lügen, Attentate, kühne Bravourstücke und Heldentode: Auch unsere zeitgenössischen Thriller-Autoren kommen auf keine höhere Ereignis-Dichte. Allerdings ist ihr Ziel in der Regel ein anderes. Stendhal nämlich hat, was immer auch er seine Romanfiguren zu tun heißt, ein zentrales Thema, das er keinen Augenblick lang aus den Augen verliert: die Leidenschaft. Das, was die Triebe mit uns anrichten, mit jedem und jeder von uns.
In seiner ebenso reizvollen wie bizarren Abhandlung "De l'Amour" ("Über die Liebe"), sechzehn Jahre vor der "Kartause" geschrieben, hatte Stendhal dazu schon einmal die Theorie geliefert. Jetzt aber demonstriert er in einem reichinstrumentierten Freilandversuch mit lebenden Menschen, wie Leidenschaft zustande kommt und unter welchen Bedingungen sie am besten gedeiht. Sein Labor ist ein mit hohem Realismus erfundenes Italien, das uns die Jahre zwischen 1796 und 1830 nahelegt - für Stendhals Zeitgenossen die jüngste Vergangenheit -, uns aber oft an ein Renaissance-Italien denken lässt, in dem die Farnese oder Medici sich und anderen ganz tatsächlich die Köpfe abschlugen. Ja, die vielen ungemein präzisen Daten und Ortsangaben haben mit einer historischen und geographischen "Wahrheit" wenig zu tun.
Die "Kartause" als Ganzes - nicht etwa nur der oder jener besonders erhitzte Handlungsteil - ist leidenschaftlich, und das heißt: erotisch aufgeladen. Tausend Volt sind die normale Betriebsspannung der Protagonisten, und ihr aller Ziel ist durchaus, in allen denkbaren Varianten, das berühmte Eine. Die Erfüllung, die Hingabe, das Glück der Eroberung. Allerdings: Es gibt bei Stendhal keine "Stellen". Keine einzige. Es gibt aber auch keinen Weichzeichner der Kamera im entscheidenden Augenblick. Man weiß, woran man ist. Um nochmals Paul Valéry zu zitieren: "Im übrigen ist er" - Stendhal also - "fast der einzige Schriftsteller, dessen Liebesszenen ich ertragen kann." Ich auch. Vor Erotik vibrierende Sätze zu schreiben und Distanz zu wahren, das beherrschte Stendhal wie kein Zweiter.
Versuchsanordnung, sagte ich. Männer und Frauen, Alte und Junge, Mächtige und Schwache, Aufgeklärte und verstockte Perückenträger: Alle verhalten sich zueinander, und alle werden, innerhalb der grotesk-rigiden Spielregeln eines absolutistisch regierten Fürstentums, von ihren Trieben gesteuert. Der Bauch - um das, was ich meine, einmal so zu nennen - ist am Ende immer stärker als der Kopf. Das Testprogramm, dem Stendhal seine Protagonisten aussetzt, ist systematisch und konsequent und so erfindungsprall, dass ich mehr oder minder die ganzen 654 Seiten bräuchte, um es nachzuzeichnen. Ich lasse es also. Es treten auf: Fabrizio del Dongo (jung; aus höchstem Adel; ein glühender Anhänger Napoleons und der neuen Ideen; mausarm; und überzeugt, er sei unfähig zu lieben). Clelia (jung; schön; keusch; fromm). Die Herzogin Sanseverina (Fabrizios mütterliche Freundin, deren Gefühle zunehmend mehr als mütterlich werden; sehr schön; sehr gewitzt). Graf Mosca (mächtiger Minister eines Herrschers, der ohne ihn nicht zurechtkäme; hat, seiner Stellung zum Trotz, hie und da liberale Anfälle; noch gewitzter als die Sanseverina, der er leidenschaftlich zugetan ist). Fürst Ernesto IV. (ein paranoides Monster mit absoluter Macht; liebt die Sanseverina so, wie Monster eben lieben). Und viele andere. Jeder kocht sein Trieb- und Machtsüppchen.
Am Anfang lässt sich Stendhal durchaus noch Zeit. Die ganze Schlacht von Waterloo findet zum Beispiel Platz, genauer gesagt, das, was der kindjunge Fabrizio von ihr mitkriegt - ein Meisterwerk, das Balzac veranlasste, einen eigenen Roman, der ein Ähnliches wollte, wegzuwerfen, und Tolstoi zu dem Geständnis brachte, er hätte ohne die "Kartause" sein "Krieg und Frieden" nie schreiben können. Dann zieht Stendhal das Tempo an. Das vielfältige Hin und Her wird immer aufregender und kulminiert endlich in einer Szene, auf die Stendhal - der beteuerte, während der Arbeit nie gewusst zu haben, wie die Geschichte denn nun weitergehen sollte - in Tat und Wahrheit von allem Anfang an zielsicher zugesteuert hat. Sie ist hochdramatisch und stellt gleichzeitig das Ergebnis des Versuchs dar.
Dieses ließe sich, wenn wir Handlung in Begriffe übersetzen, so formulieren: Leidenschaft glüht dann am heißesten, wenn die Verbote absolut und die Hindernisse unüberwindbar sind. Kerkermauern, Gelübde, Klassenschranken, der unmittelbar drohende Tod. Wenn dann diese Hindernisse doch beiseitegeschoben werden und die Verbote umgangen werden können: Dann allerdings, und nur dann, bricht sich die Leidenschaft ihre Bahn. Und wie sie das tut! Stendhals berühmte Seite 577 (in dieser Ausgabe) kommt den 451 Grad Fahrenheit, bei denen Papier brennt, sehr nahe. In Verdis Oper ("La Certosa di Parma", opera in tre atti, 1854) wäre sie gewiss der Schluss. Eine Musik von glühender Leidenschaft.
Die Szene ist ein Verlies im Turm der Zitadelle von Parma. Clelia (Sopran) stürzt in höchster Erregung in den Kerker, in dem Fabrizio (Tenor) gefangen ist. Sie liebt diesen, und dieser liebt sie, und beide haben in ihrem Leben keine drei Worte miteinander gewechselt. Sie hatte zwar der heiligen Jungfrau Maria gelobt, Fabrizio nie mehr zu sehen, nie mehr!, hat nun aber, weil sein Leben in Gefahr ist, mit der Gewissheit einer Jeanne d'Arc alle Sperren überwunden, die Schlösser eins nach dem andern aufgebrochen und die Wächter verhext. Sie ist die Treppen hinaufgeflogen schneller als ein Wind. "Gift, Geliebter!" - Da steht sie, atemlos, zitternd, unfassbar schön. Fabrizio begreift. "Ich sterbe!", singt er, obwohl er keinen Bissen von dem Pasta-Arsen-Gemisch gegessen hat, das auf seinem Tisch steht. Ein dirty trick fürwahr, und dies im sublimsten Augenblick seines Lebens. Aber er funktioniert. Clelia - Gelübde hin, Keuschheit her - sinkt in seine Arme, und "es" geschieht. "Ich sterbe mit dir!" Und während "es" andauert und die Musik jubelt, stürmen die Wachsoldaten, die aus ihrer Verzauberung erwacht sind, die Treppen hinauf. Ihr Poltern kommt immer näher. Fabrizio und Clelia singen inzwischen morendo. Die Tür knallt auf. Es ist das äußerste Glück. Vorhang.
Das Buch allerdings hört hier nicht auf. Es folgt der rasanteste Schluss der Weltliteratur. Man hat oft gesagt, der Verleger, Ambroise Dupont, habe Stendhal zu diesem Schreibgalopp gezwungen, weil er das Ganze in zwei Bände hineinkriegen wollte. Ich glaube das nicht, das heißt, der Druck des Verlegers kam dem inneren Gesetz der Handlung und damit Stendhal entgegen. Das unübersehbare Ungleichgewicht der Romankonstruktion ist gar keines. Alles ist stimmig. Nach der Seite 577 war eben, salopp gesagt, die Luft raus, und Stendhal räumte also in einem atemberaubenden Tempo mit seinem gesamten Personal auf. Am Ende sind alle tot, fast alle: "Die Gefängnisse von Parma waren leer, der Graf ungeheuer reich, Ernesto V. beliebt" - er ist der Sohn des Monsters -, "und seine Untertanen verglichen seine Herrschaft mit jener der Großherzöge der Toscana." Das Leben tut das, was es immer tut. Es geht weiter.
Anlass zu diesen Überlegungen gibt mir die neue Übersetzung der "Kartause" von Elisabeth Edl. Sie ist die erste seit 1958. Ich hatte mir fest vorgenommen, kein Wort zu ihr zu sagen, wenn ich sie nicht sehr gut finde. Der Grund dieser Zurückhaltung ist, dass die bisherige Referenz-Übersetzung, die nun diesen Rang verliert, just von meinem Vater stammt, Walter Widmer. Es ist in der Tat faszinierend und lehrreich zu sehen, wie eine Übersetzung, die einmal die Leser und Leserinnen durchaus entzückt hat, alt werden kann. Denn Elisabeth Edl tut eigentlich nichts anderes, als Stendhal unvoreingenommen und genau zu lesen. Sie hat ein wunderbar sicheres Gespür für seine Lakonie und gerät nie in Versuchung - wie dies meinem Vater immer wieder geschah -, Stendhal sozusagen nach oben zu schreiben. Ihn "besser" zu machen, "schöner", oder scheinbar unvollständige Satztrümmer stillschweigend zu ergänzen. Und warum eigentlich hat keine der bisher sieben Übersetzungen Stendhals Lauftitel mit übersetzt? Elisabeth Edl tut es. - Im Anhang ein kluges Nachwort und ein reicher Apparat: sorgfältige Anmerkungen und alle erdenklichen Materialien von Stendhals Quellen bis hin zu Balzacs fünfzigseitigem Essay, in dem dieser Stendhal ein "Genie" nannte und trotzdem fassungslos vor der Stoffdichte des Buches stand. Er hätte aus demselben Material zehn Bücher gemacht.
Stendhal: "Die Kartause von Parma". Roman. Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edl. Hanser Verlag, München 2007. 998 S., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Der Gegensatz zwischen Stendhal und Henry Miller ist nur ein Scheingegensatz. Sie gehören zusammen.« Alfred Andersch