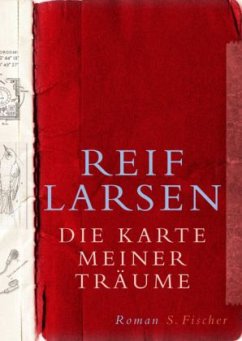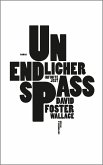T. S. Spivet ist zwölf Jahre alt und ein genialer Kartograph. Denn er weiß genau, dass nichts von Dauer ist. Der Whiskykonsum seines Vaters wird ebenso in Diagrammen festgehalten wie die Anatomie von Glühwürmchen. Inmitten seiner merkwürdigen Familie lebt er auf einer Ranch in einem flachen Tal in Montana. Und eines Nachts begibt sich T.S. auf die Reise nach Washington und damit in ein unglaubliches Abenteuer.
Reif Larsens Debüt ist ein Juwel: Ein mit vielen Karten und wundervollen Zeichnungen versehener Roman über Freundschaft, Kindheit, Schuld und über Zuhausesein. Ergreifend, geheimnisvoll und verspielt, ein wahres Feuerwerk von Gefühlen und Ideen.
"Die Karte meiner Träume" besitzt den Schimmer eines alten Hollywood-Films und ist gleichzeitig aufeinzigartige Weise neu.
Reif Larsens Debüt ist ein Juwel: Ein mit vielen Karten und wundervollen Zeichnungen versehener Roman über Freundschaft, Kindheit, Schuld und über Zuhausesein. Ergreifend, geheimnisvoll und verspielt, ein wahres Feuerwerk von Gefühlen und Ideen.
"Die Karte meiner Träume" besitzt den Schimmer eines alten Hollywood-Films und ist gleichzeitig aufeinzigartige Weise neu.

Reif Larsens weltweit gefeierter Roman "Die Karte meiner Träume" erzählt vom Versuch, die Welt im Schaubild zu erfassen - und zielt damit ins Zentrum der Wissensgesellschaft.
VON TILMAN SPRECKELSEN
Der Anruf erreicht T. S. Spivet völlig überraschend. Der Anrufer stellt sich als ein G. H. Jibsen vor, "Kustos für Illustration und Design am Smithsonian", dem berühmten naturkundlichen Institut in Washington. Er verkündet Spivet, dass der für seine Zeichnungen mit dem "hochangesehenen Preis für herausragende Leistungen in der populären Vermittlung wissenschaftlicher Sachverhalte" ausgezeichnet werden soll. Jibsen ahnt nicht, dass der prämierte Zeichner gerade einmal zwölf Jahre alt ist und sich die "wissenschaftlichen Sachverhalte", die seine Bilder vermitteln, vorwiegend autodidaktisch angeeignet hat. Spivet aber, der bei seinen Eltern auf einer Farm in Montana lebt, macht sich auf den Weg nach Washington, um seinen Preis abzuholen, und wird dabei nicht nur einen Festvortrag im Smithsonian halten, sondern sogar dem amerikanischen Präsidenten vorgestellt werden - jedenfalls beinahe.
So könnte man den Inhalt von "Die Karte meiner Träume" zusammenfassen, dem Romandebüt des 28-jährigen New Yorkers Reif Larsen, der dafür einen Vorschuss von einer Million Dollar erhielt. Gerade ist es auf Deutsch erschienen. Auf den ersten Blick reiht es sich mit seinem Thema in eine Gruppe von Büchern ein, die in den vergangenen Jahren erschienen sind und von Forschern erzählen - allen voran Daniel Kehlmanns Humboldt-Gauß-Roman "Die Vermessung der Welt". Auch Ralf Bönts Faraday-Phantasie "Die Entdeckung des Lichts" oder "Die Frau, für die ich den Computer erfand" von F. C. Delius über den Informatiker Konrad Zuse gehören in dieses Genre. Es geht den Autoren dabei, anders als den Verfassern von Wissenschaftsthrillern wie "Jurassic Park" oder "Der Schwarm", retrospektiv um Fragen der Wissenschafts- und Technikgeschichte, dargestellt an herausragenden Protagonisten. Und damit auch darum, wie die Organisation von Wissen ihre heutige Gestalt gewonnen hat.
Bei Larsen liegen die Dinge anders. Nicht nur, weil sein Roman größtenteils in der Gegenwart spielt und sein Wunderkind T. S. Spivet, dessen Genie als Zeichner von Landschaften oder schematisch reduzierten Insekten ihn zum Mitarbeiter zahlreicher renommierter Fachjournale werden lässt, eine fiktive Gestalt ist. Sondern auch, weil der Autor seinen Helden (in dessen Stammbaum er mit Charles Doolittle Walcott einen realen Paläontologen schmuggelt) kaum als Forscher, sondern als Vermittler präsentiert, der sich und anderen die Welt im Medium der Karte und der Informationsgrafik zu erschließen versucht.
Dass Larsen damit ins Zentrum der Debatte um Möglichkeiten und Grenzen der Wissensvermittlung zielt, liegt auf der Hand. Wer komplexe Zusammenhänge darstellen will, kommt heute kaum ohne Informationsgrafik aus. Das betrifft Fachzeitschriften und -bücher ebenso wie Tageszeitungen oder elektronische Medien und ist keineswegs auf Wissenschaftspublizistik beschränkt: keine Wahlsendung ohne Tortendiagramm, kein Wirtschaftsteil ohne die grafische Darstellung von Börsenkursen. Sie entstehen, indem vorhandene Daten wie Wählerstimmen oder die unterschiedlichen Börsennotierungen eines Unternehmens so in eine Grafik überführt werden, dass jeder diesen Prozess nachvollziehen kann. Das gilt auch für die Entscheidung, welche dieser Daten dargestellt werden und welche nicht: So wirkt etwa der jüngste Absturz der SPD viel dramatischer, wenn man für das entsprechende Diagramm die Wahlergebnisse seit 1998 zugrunde legt, also seit dem hohen Sieg Schröders über Kohl, und die Resultate von 1990 und 1994 nicht mit einbezieht - die horizontale Skala der Grafik bildet dann einen kürzeren Zeitraum ab. Entsprechend wirken Zuwächse beim Kurswert eines Unternehmens erheblich eindrucksvoller, wenn die vertikale Skala des betreffenden Diagramms nicht etwa bei null beginnt, sondern nur den obersten Bereich repräsentiert.
Diese eher simplen Beispiele zeigen, dass Informationsgrafiken mit ihrem Anspruch, die Welt zu erklären und überschaubarer zu machen, das Dargestellte eben auch interpretieren und den Betrachter damit unter Umständen manipulieren. Wer das weiß, wird das nicht sonderlich dramatisch finden, sondern im Einzelfall umso genauer hinsehen, welche Daten wie aufbereitet werden. Indem Reif Larsen aber nun einen Helden präsentiert, der fest an die Möglichkeit einer adäquaten Abbildung komplizierter Realien glaubt (und nur in dieser Hinsicht tatsächlich wie ein Zwölfjähriger erscheint), stellt er grundsätzliche Fragen, und dies umso wirkungsvoller und nachhaltiger, weil er sich hütet, auch nur eine von ihnen zu beantworten: Welche Rolle spielt die Informationsgrafik innerhalb des Systems, mit dem wir Forschung für Fachleute und Laien aufbereiten? Inwieweit bildet sie die Realität ab, wo ist sie Interpretation ihres Urhebers? Und welche Inhalte lassen sich auf diese Weise erfassen, wo versagt sie?
Dafür bedient sich Larsen eines alten Tricks, indem er seinen äußerst einseitig begabten Helden selbst seine Geschichte erzählen lässt. Wir sehen die Welt also mit den Augen eines verstörten, hochintelligenten Kindes, das sich von niemandem verstanden fühlt, das überdies den wenige Monate zurückliegenden Tod seines Bruders Layton verkraften muss und sich die andrängende Realität nur vom Leib halten kann, indem es sie zeichnerisch geradezu bannt. Und zu verzaubern versucht, etwa indem es den Namen des so schmerzlich vermissten Bruders ganz klein in jede Karte schmuggelt.
Der Junge jedenfalls reagiert fast hysterisch auf alles, was dieses auf Vollständigkeit angelegte Vorhaben durchkreuzt. Als seine Schwester, die er regelmäßig beim Schälen von Maiskolben beobachtet, einmal in seiner Abwesenheit damit weitermacht, stürzt er sich verzweifelt auf den Eimer mit den weggeworfenen Blättern, um die begonnene Statistik über käferbefallene Kolben korrekt fortführen zu können. Spivet zeichnet, wie andere atmen, er fertigt eine Karte vom Flusssystem seiner Heimat mit derselben Akribie an wie ein Diagramm, das die Interaktion der Familienmitglieder am Abendbrottisch oder den Whiskeykonsum seines Vaters festhält.
Von großartigen Zweifeln an seiner Perspektive erfahren wir nichts - im Gegenteil, Spivet ist überzeugt davon, dass es im Inneren jedes Menschen bereits eine Art Karte der gesamten Welt gebe, die es lediglich aufs Papier zu bringen gelte. Übersetzt man sich Spivets Lieblingswort "Karte" in "Vorstellung", dann ist damit eine traditionelle Verfahrensweise des Schriftstellers umschrieben: Der Kartograf entpuppt sich in diesem Bild auf einmal als Autor.
Von diesem Spannungsverhältnis zwischen dem objektiven Anschein der nüchternen Grafiken und dem zutiefst subjektiven Verfahren des Kartenzeichners und Informationsgrafikers lebt Larsens Buch. Spivets Lernprozess vom anfänglich geradezu enthusiastischen Positivisten, der im Smithsonian Institute das Mekka einer kritiklos bewunderten "reinen Wissenschaft" sieht, bis hin zum gründlich desillusionierten Flüchtling aus dieser Welt fungiert dabei als roter Faden. Bis dahin aber wird Spivet mit allen Aspekten eines Wissenschaftsbetriebs konfrontiert, dessen Protagonisten sein zeichnerisches Talent für ihre jeweiligen Zwecke einsetzen wollen: Sein Bild des Bombardierkäfers, lernt er, soll die Argumente der Kreationisten entkräften (als Beispiel dafür, dass sich komplexe Organismen eben doch aufs Wesentliche reduziert darstellen lassen), seine rührende Lebensgeschichte soll den wissenschaftsfeindlichen Präsidenten Bush dazu bringen, das Smithsonian großzügiger zu unterstützen.
Am Ende steht die Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die sich jeder informationsgrafischen Darstellung verweigern. Sehr hübsch zeigt sich das in einer Grafik im Schlusskapitel: Hatte Spivet zuvor die Mimik seines wortkargen, rinderzüchtenden Vaters in einer Reihe von wenigen standardisierten Bildern festgehalten, gelingt ihm das jetzt nicht einmal mehr in einer Kaskade von Bildern, die über die gesamte Seite rauschen. Und es bleibt offen, ob das Gesicht seines Vaters an Ausdrucksmöglichkeiten gewonnen hat - oder ob der Sohn auf einmal sieht, was ihm zuvor verschlossen war. Dass er der Sache mit dem Zeichenstift nicht Herr wird, ist jedenfalls sicher. Vielleicht ist das der Moment, in dem er seine Geschichte zu schreiben beginnt.
Reif Larsen: "Die Karte meiner Träume". Deutsch von Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. S. Fischer Verlag 2009.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Nach anfänglichem Interesse an dem altklugen jugendlichen Helden von Reif Larsens Debütroman "Die Karten meiner Träume" macht sich bei Rezensent Tobias Döring Überdruss bemerkbar. Der 1980 geborene amerikanische Autor, der an der Columbia Creative Writing School studiert hat, lässt einen Zwölfjährigen, der über ein gerade enzyklopädisches Wissen und Interesse verfügt, durch ganz Amerika reisen, weil er einen hochdotierten Preis für seine kartografischen Fähigkeiten entgegennehmen soll, fasst der Rezensent zusammen. Der Autor lässt verrückte Dialoge mit Lokomotiven, die den Jungen nach seiner Haltung zu Jean-Jacques Rousseau befragen, und überhaupt jede Menge schräge und skurrile Ereignisse und Exkurse einfließen, stellt der Rezensent fest. Als wäre dies alles noch nicht genug, erscheinen auf jeder Seite Karten, Zeichnungen, Randbemerkungen und Abschweifungen, die die Geschichte ziemlich ausufern lassen. Für Döring riecht das Ganze irgendwann nur noch nach allzu bemühter Originalität, die er zunehmend enervierend findet. Dass dann, nachdem man den frühreifen Jungen als Genie in den Talkshows gefeiert hat, auch noch ein wüstes Verschwörungsszenario zutage tritt, macht den Rezensenten noch unzufriedener. Allerdings weist er ausdrücklich auf die großartige Leistung der beiden Übersetzer hin, was aber den Roman in seinen Augen nicht retten kann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH