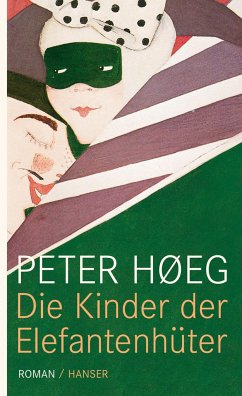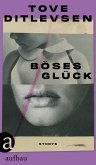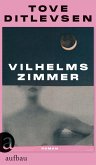Auf den ersten Blick sind die Finos aus Dänemark eine ganz normale Familie: Der Vater ist Pastor, die Mutter spielt Orgel, Peters großer Bruder studiert Astronomie. Doch an einem Karfreitag sind plötzlich die Eltern verschwunden, die schon einmal durch zweifelhafte Wundertaten mit der Justiz in Konflikt geraten waren. Um Vater und Mutter vor weiteren Torheiten zu bewahren, beginnen Peter und seine Schwester Tilte eine großangelegte Suchaktion. Inmitten falscher Heiliger und fanatischer Sinnsucher finden sie ihre eigene Tür zur Freiheit und zum Glück. Peter Hoegs spannender und temporeicher Roman ist ein Abenteuer voller filmreifer Szenen, aktueller Anspielungen und verrückter Einfälle. Der Autor von "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" zeigt erneut seine mitreißende Fabulierkunst.

Widerstand zwecklos: Peter Høeg erweist sich mit seinem neuen Roman als Meister einer Scharlatanerie, die glücklich macht.
Von Wiebke Porombka
Der erste Satz ist eine Katastrophe: "Ich habe eine Tür aus dem Gefängnis gefunden, die sich zur Freiheit öffnet", lautet er, "ich schreibe dies, um dir die Tür zu zeigen." Aber es ist eben nur der erste Satz. Spätestens auf Seite fünf hat es einem die Tränen in die Augen getrieben (vor Wut) oder rote Flecken ins Gesicht - vom hektischen Nachdenken darüber, wie um alles in der Welt man die noch folgenden vierhundertsiebenundsiebzig Seiten von Peter Høegs neuem Roman überstehen soll: Vierzehn Jahre alt ist der Erzähler, was allein schon heikel ist. Noch dazu tischt er pausenlos - halb fraternisierend, halb altklug - esoterische Selbstfindungsfloskeln auf. Als dann noch das Thema Kindsmissbrauch gestreut wird - "unterschwellig" wäre in diesem Fall ein Euphemismus -, ist man derart zermürbt, dass man nah daran ist, sich hilf- und ratlos all jenem zu fügen, was Peter Høeg noch an Seelenzauberei bereithält.
Dass Høeg nicht nur einen Hang zum Übersinnlichen, sondern ein Faible für Spielarten der Transzendenzsuche hat, ist seit seinem Bestseller "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" kein Geheimnis. Ebenso wenig ist es eines, dass der hochgewachsene Däne selbst eine sonderbare Gestalt ist. Zehn Jahre hat er sich nach seinem Erfolgsroman komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, bis er selbst zum Mysterium geworden war. Erst im Jahr 2006 kehrte er mit "Das stille Mädchen" an die Öffentlichkeit zurück.
Man hätte wissen müssen, worauf man sich einlässt. Und doch weiß man es bei seinem neuen Buch "Die Kinder der Elefantenhüter" selbst dann noch nicht, als man es verstimmt zu wissen meint. Und, um es gleich vorwegzunehmen, das ist das Hinreißende an dem Roman. Peter heißt der junge Erzähler, der zwischen all seinen Erlösungspostulaten zunächst seine Familie vorstellt. Zwar geht es nicht um tatsächliche Elefantenhüter, sondern es klingt kaum weniger unglaubwürdig, was unter normalen Umständen so beschaulich anmuten müsste. Aber normal ist hier wenig. Auf einem Pfarrhof auf der dänischen Insel Finø lebt Peter mit seinen Geschwistern Hans und Tilte, es gibt eine liebenswerte Urgroßmutter und eigenartige Eltern, die aber gerade Urlaub machen. Und es scheint nicht das erste Mal zu sein, dass dieses Pfarrerspaar unter vorgeschützten Gründen verschwunden ist.
Peter zufolge sind seine Eltern veritable Hochstapler, die mit Taschenspielertricks den Gottesdienst auf Finø in einen Reigen von Wundern und Epiphanien verwandeln. Mal sind es nur ein paar Ziegel, die an passender Stelle der Predigt vom Dach rutschen, mal schwebt auf das Stichwort vom Heiligen Geist eine weiße Taube aus der Kuppel. Während der Vater auf der Kanzel den Zampano gibt, ist die Mutter für die Technik im Hintergrund verantwortlich. Nicht nur der Gottesdienst, auch das Haus der Familie ist bestückt mit Mechanismen, die per Stimmenerkennung oder durch das Singen bestimmter Melodien ausgelöst werden: Lichter einschalten oder Türen öffnen.
Der Wunder-Gottesdienst funktioniert blendend, die Leute strömen in Scharen in die Kirche, man expandiert. Fortan werden auch auf dem Festland die Gläubigen durch wackelnde Altäre und Theaternebel in Verzückung gesetzt, bis eines Tages - die Kinder möchten vor Scham im Boden versinken - die Eltern, unmoralisch bis in die Fingerspitzen, in rotem Ferrari und feinem Pelz ins Pfarrhaus zurückkehren. Kein Wunder angesichts all der fadenscheinigen Wunder, dass den Kindern Böses schwant, als die Eltern abermals verschwinden.
Was Peter Høeg seinen Erzähler machen lässt, hat mindestens so viele doppelte Böden wie die mechanischen Basteleien der Mutter. Indem es immer unwahrscheinlicher und himmelschreiender wird, was er seinen Eltern andichtet, untergräbt er seine eigene Glaubwürdigkeit, was noch verstärkt wird, da er seine Geschwister im Gegensatz zu den Eltern als wahre Lichtgestalten daherkommen lässt: Hans ist ein blondgelockter, bildhübscher und herzensguter Hüne, der umstandslos in jedes Märchen adaptiert werden könnte, die sechzehnjährige Tilte, braungebrannt und rothaarig, hat neben abseitigen Leidenschaften beispielsweise für Särge in etwa die magischen Kräfte von Pippi Langstrumpf.
Mag sein, dass man es hier mit den schwärmerischen Projektionen eines kleinen Bruders zu tun hat. Mag sein, dass er der ausgebuffteste Hochstapler von allen ist. Deshalb erscheint zunehmend auch das, was er nach wie vor beständig an Selbstfindungs- und Erlösungsmystik einflicht, wenn nicht als Scharlatanerie, so doch als rhetorisches Sentimentalitätsmanöver, um die Leser auf seine Seite zu ziehen. "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit" lauten diese Sätze, die immer schamloser und zugleich lustiger erscheinen, je mehr sie den Grad der Übertreibung der Räuber-und-Gendarm-Geschichte erreichen, die sich da entspinnt.
Die Kinder meinen, Beweise dafür zu haben, dass ihre Erzeuger dieses Mal auf sicherem Weg ins Verderben und ins Gefängnis sind, und versuchen ihnen deshalb vor der Polizei auf die Spur zu kommen. Gleichzeitig flüchten sie selbst vor einem merkwürdiges Grüppchen aus Psychologen und Beamten, das sie ins Kinderheim bringen will. Während der doppelten Jagd im Stile rasanter Tür-auf-Tür-zu-Komödien werden geheime Räume im Pfarrhaus entdeckt, Computer gehackt und Autos gestohlen, und es wird mit homosexuellen und drogenabhängigen Adligen geschachert. Nebenbei aber geht es um nichts weniger als um einen Kongress der Weltreligionen und einen unvorstellbar großen Schatz, der auch noch gerettet werden muss. Und immer wenn man denkt, nun ginge es nicht mehr verrückter, sagt Peter auch schon: Aber nun pass auf! Und es geht noch verrückter.
An Wunder muss man glauben. Genauso, wie die Gemeinde sich vom Hokuspokus des hochstapelnden Ehepaars verzücken lässt, geht es dem Leser mit Høegs Roman. Es mag keine große Philosophie des Glücks sein, die Høeg da entfaltet, dafür führt er denkbar einfach vor, wie sich zumindest ephemere Momente dessen einstellen: im fassungslosen Lachen. Die Momente gibt es unzählige in diesem Buch, dessen Größe darin besteht, dass Høeg selbst das, was ihm ernst ist, in einen gigantischen Spaß verwandelt, wenn es der Sache dient. Natürlich kann man die irrwitzige, kalauernde, traumgleiche Heldengeschichte eines Jungen in all ihrer Lustigkeit auch als Parabel lesen, als ein Anreden und einen Protest gegen die Einsamkeit, die mit dem Erwachsenwerden und dem Herausgeschmissenwerden aus der heilen Kinderwelt unaufhaltsam einsetzt. Dem einen wie dem anderen kann man sich kaum entziehen.
Peter Høeg: "Die Kinder der Elefantenhüter". Roman. Aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle. Hanser Verlag, München 2010. 488 S., geb., 21,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Nach dem allseits bemäkelten literarischen Comeback des dänischen Erfolgsautors Peter Hoeg von 2006 zeigt sich Kristina Maidt-Zinke von seinem jüngsten Werk eher angenehm überrascht. Natürlich begibt sich der Autor auch diesmal auf eine "spirituelle Sinnsuche", indem er drei Pfarrerskinder auf der Suche nach ihren verschwundenen Eltern den Weltfrieden retten lässt. All dies geschieht aber mit einem 14-jährigen, wunderbar unterhaltsamen Erzähler, der witzig, altklug und ironisch so manche Astrid-Lindgren-Figur ins Gedächtnis ruft, wie die Rezensentin amüsiert bemerkt. Zugegeben, die Spannung der Handlung hält sich streckenweise in Grenzen, und die große Frage nach Möglichkeiten der Freiheit, die Hoeg hier verfolgt, wird natürlich trotz Happy End nicht abschließend geklärt, räumt Maidt-Zinke ein. Trotzdem klappt sie das Buch mit einem guten Gefühl zu, wenn sie dem Buch auch Schwierigkeiten dafür prophezeit, dass es seine Zielgruppe - jugendliche oder erwachsene Leser - nicht eindeutiger definiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Voller Witz und Fabulierfreude, mit ausgeprägtem Sinn für Abseitiges und Skurriles, verbindet Høeg Familiendrama und Schelmenroman, Religionskritik und Kriminalroman." Jörg Böckem, KulturSPIEGEL, 10/2010 "Der neue Roman des dänischen Autors Peter Høeg ist Räuberpistole, Kriminalgeschichte, Entwicklungsroman, er ist verrückt und großartig und voller Superhelden, deren Superkräfte allein darin bestehen, sich auf die eigene, innere Kraft zu verlassen. ... Mit viel Fantasie und herrlicher Lakonik rennt Peter Høeg mit dem Leser durch die Geschichte. Sein Humor ist treffend, ganz leise, ganz bescheiden. ... Und am Ende hat man mehr verstanden über Liebe, Einsamkeit und Freiheit. Auch, dass es keine Antworten gibt, nur Ahnungen - und die Sehnsucht." Daniela Zinser, die tageszeitung, 27.11.10 "Widerstand zwecklos: Peter Høeg erweist sich mit seinem neuen Roman als Meister einer Scharlatanerie, die glücklich macht. ... Die Größe dieses Buches besteht darin, dass Høeg selbst das, was ihm ernst ist, in einen gigantischen Spaß verwandelt, wenn es der Sache dient. Natürlich kann man die irrwitzige, kalauernde, traumgleiche Heldengeschichte eines Jungen in all ihrer Lustigkeit auch als Parabel lesen, als ein Anreden und einen Protest gegen die Einsamkeit, die mit dem Erwachsenwerden und dem Herausgeschmissenwerden aus der heilen Kinderwelt unaufhaltsam einsetzt. Dem einen wie dem anderen kann man sich kaum entziehen." Wiebke Porombka, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.11.10 "Freundlich, hell und angenehm unernst ... Allerlei komische Volten, Rückblicke und Seitenblicke auf Gegenwartsphänomene." Kristina Maidt-Zinke, Süddeutsche Zeitung, 11.01.11"Er kann das. Eine Geschichte spinnen, dass einem schwindlig wird. Einen Wortteppich weben, auf dem man davonschwebt. Bilder erzeugen, eines opulenter als das andere. Der Däne Peter Høeg ist ein Zaubermeister in der Alchemistenküche der schönen Literatur." Uwe Stolzmann, Neue Zürcher Zeitung, 20.01.11
"Spannend, voller unerwarteter Wendungen und temporeich ist die Hörbuchadaption des tollen Fabulierkünstlers Peter Hoeg."