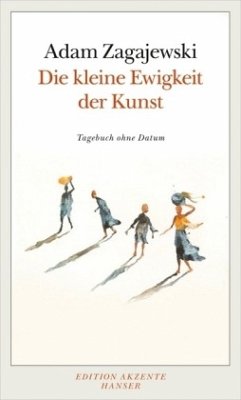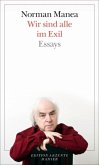Adam Zagajewskis neues Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Unentbehrlichkeit der Kunst in der modernen Welt. Es ist ein Tagebuch ohne Datum, es verbindet das Persönliche mit dem Allgemeinen. Adam Zagajewski erzählt darin von seiner Geburtsstadt Lemberg, von der Aussiedlung der Familie, von Städten, in denen er gelebt hat: Paris, Houston, Berlin, Krakau. Dabei führen die privaten Erfahrungen immer auch zu einer neuen Sicht auf die Welt. Und wenn es um Literatur geht - Rilke, Kafka, Simone Weil, Cioran, Milosz - schreibt der mehrfach ausgezeichnete Autor aus Polen nicht nur über die Werke, sondern auch über die Grenze zwischen Leben und Kunst. Diese klugen, wohlkomponierten Aufzeichnungen sind Zagajewskis schönstes Prosabuch.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Adam Zagajewski nennt sein Buch "Die kleine Ewigkeit der Kunst" auch ein "Tagebuch ohne Datum", was für Volker Breidecker besonders anschaulich macht, wie dieses Buch verfasst ist: als Selbstschau und Erinnerung, der durch das fehlende Datum aber gleichsam die Chronologie abhanden gekommen ist, erklärt der Rezensent. Zagajewski stellt Poesie und Prosa gegenüber und nebeneinander, verdichtet Miniaturen zu Epigrammen, gedenkt toter wie lebender Freunde, erinnert sich an die Deportation aus Lemberg und das Leid der verloren Heimat, die in der Kunst selbst gesetzt werden muss, fasst Breidecker zusammen. "Die Dichter bauen ein Haus für uns - doch sie selbst / können nicht darin wohnen", zitiert der Rezensent und erklärt: Zagajewski gelinge das Lob der dichterischen Epiphanie ohne religiös-mytisches Pathos.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Adam Zagajewski taucht in "Tagebuch ohne Datum" in seine Geschichte ein
"Wenn ich Romane schreiben könnte, würde ich mich vielleicht an einem Roman über einen Menschen versuchen, der sein Leben nur auf die kurzen, intensiven Momente mystischer Öffnung ausrichtet", schreibt Adam Zagajewski, einer der bekanntesten Lyriker Polens, der zwischen 1974 und 1983 neben großartigen Gedichtbänden und heftig diskutierten politischen Essays auch drei nicht sehr gelungene Romane verfasste. Einen Roman wollte er hier sicher nicht schreiben, doch reizt und beflügelt ihn das Medium Prosa spürbar. Wenn die Lyrik auf den Moment ausgerichtet ist, wie er sagt, dann liefert die Prosa die Verbindungsstücke zwischen den Einschlägen fragloser Erkenntnis, den "kleinen Ewigkeiten", die ihn unvermutet überfallen und die er weder festhalten noch erklären kann.
"Es gab zu viel / Lemberg, es paßte in kein Gefäß, / sprengte die Gläser, ergoß sich aus / Teichen, Seen, rauchte aus allen / Schornsteinen, wurde zu Feuer und Sturm, / lachte mit Blitzen, / besänftigte sich", heißt es im Titelgedicht seines berühmten Bandes "Nach Lemberg fahren", in dem Zagajewski den Mythos der verlorenen Heimatstadt Lwiw beschwört. Dort wurde er 1945 geboren, und nachdem die Stadt an die Sowjetunion gefallen war, wurde seine Familie vertrieben und fand in Gleiwitz - keine neue Heimat. Es schien ihm, als würden die Eltern, die Onkel und Tanten wie Schlafwandler durch die fremden Straßen laufen, auch nach dreißig Jahren noch. Dieser Eindruck, so hält er in seinen Notizen fest, verstörte ihn als Kind zutiefst - vielleicht war er sogar für ihn, den "Vertriebenen der zweiten Generation", Auslöser des Schreibens.
Das tagebuchartige, unter dem Titel "Die kleine Ewigkeit der Kunst" erschienene Kompendium ist über Jahre gewachsen, und man kann es als das sehr persönliche Logbuch einer geistigen Abenteuerfahrt und ihrer vielen Exilstationen lesen. "Ich sollte notieren", heißt es, bevor er in eine philosophische und hochemotionale Interpretation der Musik Gustav Mahlers eintaucht, die ihn geprägt hat - wie überhaupt Musik, neben der Familiengeschichte, eine entscheidende Rolle in diesem Buch spielt. Vom schweigsamen und couragierten Vater erfuhr er als Kind fast nichts und bat ihn im Alter, seine Erinnerungen aufzuschreiben - sie bilden den innersten Kern dieser Aufzeichnungen.
Wenn er durch Krakau, Houston (wo er lehrte) oder Berlin wandert, freut er sich an Klängen und Farben, an Gesichtern und Bewegungen, und immer hat er ein Buch in der Tasche: in Paris (wo er bis 2002 lebte) meist die Tagebücher des polnischen Emigranten Józef Czapski, dessen Eindrücke sich über die realen Straßen und Parks legen "wie eine Kopie über das Original" und sein eigenes Erzählen herausfordern. Er beschreibt verzweifelte Telefonate mit Nobelpreisträger Czeslaw Milosz, als dessen literarischer Erbe er gilt, porträtiert seelenverwandte Lyriker wie Joseph Brodsky und Zbigniew Herbert, erklärt seine Verehrung für Simone Weil, schildert Schreibblockaden und schwärmt von den Gedichten Gottfried Benns, die ihn immer aufs Neue "elektrisieren". Es sind die anrührenden, oft selbstironischen Notizen eines sehr ehrlichen Menschen, der den alltäglichen Zwiespalt zwischen Höhenflug und Absturz beim Schreiben als etwas "Unseriöses" empfindet. Gleichzeitig verlangt er von der Dichtung, mit ihrer sprachlichen Schönheit immer wieder Antworten auf den Zustand der Welt zu geben, "der sich in tausend Formen ausdrückt, im Kummer des Arbeitslosen, der an einem heiteren Apriltag auf einer Parkbank sitzt, ebenso wie in einem philosophischen Traktat oder einer Symphonie".
NICOLE HENNEBERG.
Adam Zagajewski: "Die kleine Ewigkeit der Kunst". Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann und Renate Schmidgall.
Carl Hanser Verlag, München 2014. 320 S., geb., 21,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Kunstvoll." Adam Soboczynski, Die Zeit. 26.03.15
"[...] man kann es als das sehr persönliche Logbuch einer geistigen Abenteuerfahrt und ihrer vielen Exilstationen lesen." Nicole Henneberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.02.15
"Nun, da man es in den Händen hält, merkt man, wie sehr man sich nach einem solchen Buch gesehnt hat - einem Buch, das die Kunst ernst und das Leben heiter nimmt, das Tiefe mit Ironie, Überschwang mi Abgeklärtheit, Gelehrsamkeit mit Leichtigkeit, Abstraktion mit Anschauung und Essay mit Erzählung verbindet." Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung, 10.02.15
"Mit Adam Zagajewski durch Europa zu gehen, das ist, als ginge man durch ein großes Buch, in dem alle Weisheit zusammengeführt wird." Volker Weidermann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 28.12.14
"'Es sind die schönsten Stellen des Buches, wo er auf seinen zahlreichen Reisen den Atem anhält und in poetiscnen Bonmots und Meditationen zu uns spricht." Artur Becker, Frankfurter Rundschau, 07.10.14
"Glänzend beobachtet, dicht geschrieben." Gregor Dotzauer, Tagesspiegel, 06.12.14
"[...] man kann es als das sehr persönliche Logbuch einer geistigen Abenteuerfahrt und ihrer vielen Exilstationen lesen." Nicole Henneberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.02.15
"Nun, da man es in den Händen hält, merkt man, wie sehr man sich nach einem solchen Buch gesehnt hat - einem Buch, das die Kunst ernst und das Leben heiter nimmt, das Tiefe mit Ironie, Überschwang mi Abgeklärtheit, Gelehrsamkeit mit Leichtigkeit, Abstraktion mit Anschauung und Essay mit Erzählung verbindet." Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung, 10.02.15
"Mit Adam Zagajewski durch Europa zu gehen, das ist, als ginge man durch ein großes Buch, in dem alle Weisheit zusammengeführt wird." Volker Weidermann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 28.12.14
"'Es sind die schönsten Stellen des Buches, wo er auf seinen zahlreichen Reisen den Atem anhält und in poetiscnen Bonmots und Meditationen zu uns spricht." Artur Becker, Frankfurter Rundschau, 07.10.14
"Glänzend beobachtet, dicht geschrieben." Gregor Dotzauer, Tagesspiegel, 06.12.14