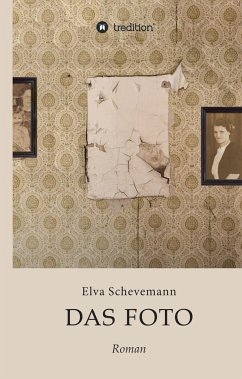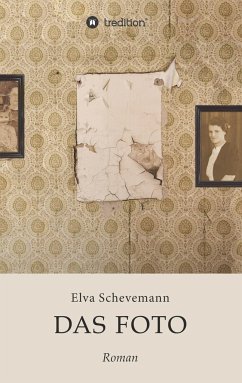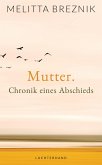Die 1960er Jahre. Bundesrepublik Deutschland. Im rheinischen Troisdorf betreiben die Eltern des Erzählers ein gutgehendes Fotoatelier. Nach außen hin demonstriert man seinen Status: Häuser. Neues Auto. Sonntäglicher Kirchgang - zumindest der Frauen und des Kindes. Doch hinter der gutbürgerlichen Fassade legen die Familienmitglieder verstörende Verhaltensweisen an den Tag. Was treibt die Eltern um, die während des Zweiten Weltkriegs bereits junge Erwachsene waren? Warum verabscheut die Oma, die zwei Weltkriege erlebte, ihren Enkel? In einem weiten Bogen erzählt Andreas Fischer die Geschichte seiner Familie von 1914 bis 2014, vom Einsatz des Großvaters als Soldat im Ersten Weltkrieg bis zum Tod der Mutter. Der Autor verwebt Familienereignisse, die vor seiner Geburt lagen, mit Szenen aus seiner Kindheit und Dokumenten aus unterschiedlichen Quellen: Briefe des gefallenen Bruders der Mutter finden sich ebenso wie Unterlagen aus Militärarchiven. Ein Kriegsenkelroman. Bereits in mehreren Dokumentarfilmen beschäftigte sich Andreas Fischer mit der Frage, wie sich kriegsbedingte Verluste und Traumata generationenübergreifend auf Familien auswirken, so in Söhne ohne Väter ZDF, 2007 und Der Hamburger Feuersturm 1943 NDR, 2009.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Sebastian Schoepp hat nichts dagegen, dass immer mehr Boomer ihre Nachkriegskindheit in der BRD aufschreiben. Vor allem nicht, wenn sie es so bewegend tun wie der Dokumentarfilmer Andreas Fischer, der hier erzählt, wie er im Mief aus unverarbeiteten Kriegstraumata als Kind nur im Weg herumstand. Vernachlässigt von den Eltern, die an ihrem Schweigen zu ersticken drohten, gilt er der Großmutter, der titelgebenden "Königin von Troisdorf" als enttäuschender Ersatz für den gefallenen Sohn, der für Hitler kämpfte, resümiert der Kritiker. Statt von Gewalt und Missbrauch ist Fischers Kindheit von alltäglichen "Mikrograusamkeiten" geprägt, erläutert Schoepp: Schuld, Verlust, Kleinbürger-Träume und Enttäuschung über den verlorenen Krieg bilden die Sphäre, in der Fischer aufwächst. Wie präzise und effektiv der Autor seine Familiengeschichte aus Briefen, Erinnerungen und Dokumenten rekonstruiert, findet der Rezensent bemerkenswert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH