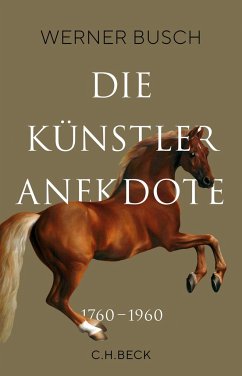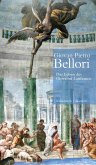Anekdoten sind keineswegs immer nur harmlose Geschichten mit einer überraschenden Pointe. Vielmehr waren sie von ihren antiken Anfängen an einer anderen - oft subversiven - Wahrheit verpflichtet als die offizielle Geschichtsschreibung. Auch Künstleranekdoten verraten mehr über die Künstler und ihr Werk, als es scheint. Der renommierte Kunsthistoriker Werner Busch zeigt dies in bestechender Weise an bedeutenden Malern von Thomas Gainsborough über Adolph Menzel und William Turner bis zu Mark Rothko.
Im 18. und 19. Jahrhundert erlebte die Anekdote vor allem in England eine Blütezeit, wobei fast jeder bedeutendere Künstler eine Anekdotensammlung bekam. Diese Anekdoten mögen nicht immer den Wahrheitsansprüchen der empirischen Geschichtsschreibung genügen. Trotzdem - oder vielleicht gerade deswegen - können sie helfen, die Werke etwa von George Stubbs, von Thomas Gainsborough und William Turner zu entschlüsseln. Auch im 20. Jahrhundert spielte die Anekdote bei Malern des Abstrakten Expressionismus eine verblüffende Rolle. Die Geschichten, die die Künstler zumeist selber in Umlauf brachten, sind Ausdruck von Gegenpositionen gegenüber etablierten Überzeugungen, sie antworten auf Künstlerkollegen wie auf die Kunstkritik. Und die Bilder von Mark Rothko erzählen selbst Geschichten, die sich gegen die falsche Vereinnahmung der Werke wenden. Mit kriminalistischem Spürsinn hebt Werner Busch mithilfe von Künstleranekdoten verhüllte oder verschüttete Bedeutungen großer Kunstwerke ans Licht.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Im 18. und 19. Jahrhundert erlebte die Anekdote vor allem in England eine Blütezeit, wobei fast jeder bedeutendere Künstler eine Anekdotensammlung bekam. Diese Anekdoten mögen nicht immer den Wahrheitsansprüchen der empirischen Geschichtsschreibung genügen. Trotzdem - oder vielleicht gerade deswegen - können sie helfen, die Werke etwa von George Stubbs, von Thomas Gainsborough und William Turner zu entschlüsseln. Auch im 20. Jahrhundert spielte die Anekdote bei Malern des Abstrakten Expressionismus eine verblüffende Rolle. Die Geschichten, die die Künstler zumeist selber in Umlauf brachten, sind Ausdruck von Gegenpositionen gegenüber etablierten Überzeugungen, sie antworten auf Künstlerkollegen wie auf die Kunstkritik. Und die Bilder von Mark Rothko erzählen selbst Geschichten, die sich gegen die falsche Vereinnahmung der Werke wenden. Mit kriminalistischem Spürsinn hebt Werner Busch mithilfe von Künstleranekdoten verhüllte oder verschüttete Bedeutungen großer Kunstwerke ans Licht.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Kleine Geschichten verraten mitunter mehr als große Programme: Werner Busch prüft Künstleranekdoten auf ihren Erkenntniswert.
Von Kai Spanke
Museumsbesuche sind ein schöner, aber oft auch seltsamer Zeitvertreib. Denn wer die Sammlungen großer Häuser durchstreift, wird darüber staunen, wie vorhersehbar sich das Nacheinander der Werke darstellt. Geschichte erscheint als nahtlose Entwicklung, die sich ohne Probleme in ästhetische Lösungen übersetzen lässt. Die vermeintliche Kontinuität ist nicht zufällig zum musealen Standard geworden. Vielmehr hat sie zahlreiche Fürsprecher, die ihr über Fachgrenzen hinaus Geltung verschaffen. Der wichtigste unter ihnen war Ernst Gombrich, dessen Monographie zur Geschichte der Kunst so gut lesbar ist, weil sie ihren Gegenstand in einen Prozess ohne nennenswerte Widerstände einbettet.
Solch eine Ordnung lässt für Brüche genauso wenig Platz wie für jene scheinbaren Petitessen, die bedeutende Ereignisse flankieren. Das ist bedauerlich, denn auch Details am historischen Wegesrand könnten ein Schlüssel zum Verständnis einer Person oder Begebenheit sein. In keiner Textform sind diese großen Kleinigkeiten besser aufgehoben als in der Anekdote. Sie liefert Gegenentwürfe zur Geschichtsschreibung und taugt als Korrektiv staatstragender Erzählungen. Obwohl ihr Wahrheitsgehalt oft in Frage gestellt werden muss, kann sie dabei helfen, eine Sache in höherer Auflösung zu erkennen. Eine Anekdote als solche zu identifizieren ist nicht schwer, sie zu definieren kann allerdings zur Herausforderung werden, da sie, je nach Funktion, Zeit und Kontext, unterschiedliche Gestalt annimmt.
Werner Busch, von 1988 bis 2010 Professor für Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin, hat sich mit einem speziellen Typus dieser Gattung auseinandergesetzt - der Künstleranekdote. Sie geht zum größten Teil auf antike Viten zurück, die Plinius der Ältere im fünfunddreißigsten Buch seiner "Naturgeschichte" überliefert hatte. Busch zufolge trat sie für europäische Maler an die "Stelle der klassischen Kunsttheorie, die auf Idealisierung zielte". Da es eine grundlegende Doktrin realistischer Kunst nie gegeben hatte, mussten sich Maler, denen es um direktere Abbildungen der Wirklichkeit ging, "die Abqualifizierung ihres Zugriffs durch die der Klassik verpflichteten Künstler gefallen lassen".
Die einzelne Anekdote ist für Busch nicht um ihrer selbst willen von Interesse. Vielmehr fragt er sich, ob ein Forscher, der sie entschlüsseln kann, das Werk des Künstlers so besser begreift als durch die "Rekonstruktion quellengestützter, faktenmäßig unterfütterter historischer Zusammenhänge". Pate dieser Idee ist der New Historicism, dessen Vertreter, allen voran Stephen Greenblatt, gerade den abwegigen Seiten der Anekdote einen Erkenntniswert zuschreiben. Sie bringe "das Andersartige der Vergangenheit zum Vorschein, das Heterogene, Übersehene, Irritierende, das die offizielle Geschichtsschreibung gern unterschlägt".
Während sich der New Historicism vor allem um die Renaissance verdient gemacht hat, beschränkt sich Busch auf die Zeit vom achtzehnten bis zum zwanzigsten Jahrhundert. Das liegt unter anderem daran, dass um 1750 das Ende der klassischen Kunsttheorie und einer rhetorischen Tradition erreicht war, "zu deren Bestandteilen die Anekdote als bildhafte Sprachregelung gehörte". Unter diesen Umständen erscheint die nach wie vor populäre Künstleranekdote besonders instruktiv, weil ihre Funktion im Wesentlichen unverändert blieb: Sie beschreibt den geglückten direkten Zugriff des Künstlers auf die Natur.
Das illustrieren etwa viele Werke des Engländers George Stubbs (1724 bis 1806). Um 1762 fertigte er ein monumentales Porträt des arabischen Hengstes Whistlejacket an. Das Pferd gehörte dem zweiten Marquess of Rockingham, Charles Watson-Wentworth. Auf dem Gemälde dreht es den Kopf zum Betrachter und steht in der Levade da. Diese Pose gebührt als Zeichen der Überlegenheit eigentlich dem aufgesattelten Herrscher. Deswegen nahm man an, Stubbs habe nur den Auftrag erhalten, das Pferd zu malen, während andere Künstler den König und den Hintergrund beisteuern sollten. Busch zweifelt an dieser Darstellung, weil Rockingham wahrscheinlich längst mit George III. gebrochen hatte, als er das Bild in Auftrag gab.
Details zu Stubbs' Leben finden sich in einem Text seines Kollegen und Freundes Ozias Humphry. Darin ist zu lesen, Stubbs habe das fast vollendete Gemälde einmal so aufgestellt, dass Whistlejacket einen Blick darauf erhaschen konnte. Der Hengst sei sofort in höchste Erregung verfallen und zum Angriff übergegangen. Nachdem Rockingham davon hörte, habe er angeordnet, das Porträt solle nur das Pferd vor neutralem Hintergrund zeigen. In dieser Anekdote erkennt Busch eine rhetorische Figur, welche die theoretische Position des Künstlers markiert. Humphry wolle den "Wirklichkeitszugriff von Stubbs nicht nur rechtfertigen, sondern als eine eigenständige künstlerische Qualität herausstreichen, die gleichberechtigt neben einer klassisch-idealistischen Kunstauffassung steht". Vorbild ist Vasari. In seinen Viten erwähnt er ein gemaltes Pferd, das Bramantino so naturgetreu hinbekommen habe, dass es von einem lebenden attackiert worden sei.
Über Thomas Gainsborough (1727 bis 1788) sind etliche Anekdoten in Umlauf, die sich um seine Instrumentensammlung drehen. Einmal habe er einen deutschen Musikprofessor aufgesucht und ihm gesagt, er wolle dessen Laute kaufen. Keine Chance. Daraufhin habe Gainsborough eine so absurd hohe Summe geboten, dass der Handel doch zustande gekommen sei. Als Nächstes habe er die Kompositionen des Professors für die Laute erwerben wollen, um schließlich darauf zu bestehen, von ihm unterrichtet zu werden. So berichtet es der schottische Autor Allan Cunningham im Jahr 1829. Für Busch drückt sich in Gainsboroughs "Instrumentenmanie" eine "Sehnsucht nach den perfekten Tönen aus, und diese Suche dürfte als Metapher für die absolute Tonalität in der Malerei stehen".
Eines der eindrucksvollsten Bilder von William Turner (1775 bis 1851) ist "Snow Storm" von 1842. Es zeigt ein Schiff im Schneesturm, das sich aufgrund des skizzenhaften Stils in Form- und Farbwirbeln auflöst. Turner verbreitete damals, er habe sich bei einem Unwetter von der Mannschaft des Dampfers Ariel an den Mast fesseln lassen, um die Naturgewalt so unmittelbar wie möglich zu erleben. Einerseits macht er sich so zum Nachfolger des Odysseus, der sich während seiner Irrfahrt an einen Mast binden ließ, um dem Gesang der Sirenen zu widerstehen. Andererseits bezieht er sich auf den Luftgeist Ariel in Shakespeares "Sturm". Ob eindeutige Referenz oder Flunkerei, sachkundig und stilsicher zeigt Werner Busch, wie solche Anekdoten ein Werk im kulturellen Raum verorten und theoretisch bestimmen. Davon profitiert nicht nur die Kunstgeschichte, sondern auch der auf Ordnung konditionierte Blick des Museumsbesuchers.
Werner Busch: "Die Künstleranekdote".
1760-1960.
C. H. Beck Verlag, München 2020. 303 S., Abb., geb., 29,95 [Euro].
Erscheint am 16. Oktober.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Eine geschlossen oder vollständige Geschichte der Künstleranekdote bekommt Rezensent Lothar Müller bei Werner Busch mitnichten. Was der Kunsthistoriker stattdessen vor allem liefert, eine Aufsatzsammlung mit Betrachtererfahrungen zu George Stubbs, Turner, Gainsborough, Rothko, Newman, Menzel u.a., enthält für Müller jedoch allerhand Anregendes. Und wenn der Autor von hier aus dann doch, wenngleich nicht eben quellengenau, wie Müller festhält, auf die Funktion der Künstleranekdote kommt, "leicht vereinfacht" meist, fällt auch Erkenntnis für den kritischen Rezensenten ab.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Werner Busch, virtuoser Kunsthistoriker, der er ist, schaut sich die Bilder eines Künstlers an, dann die Anekdoten, die über ihn kursieren, und schließlich setzt er sich in der Lücke fest zwischen dem, was die Anekdoten behaupten, und dem, was er auf den Bildern sieht."
Süddeutsche Zeitung, Lothar Müller
"Busch (...) will die Anekdote nicht simpel als Hokuspokus entlarven, sondern verbindet sie elegant mit detailseliger Werkbetrachtung und Wirkungsgeschichte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit."
ZEIT, Alexander Cammann
"Sachkundig und stilsicher zeigt Werner Busch, wie solche Anekdoten ein Werk im kulturellen Raum verorten und theoretisch bestimmen. Davon profitiert nicht nur die Kunstgeschichte, sondern auch der auf Ordnung konditionierte Blick des Museumsbesuchers."
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kai Spanke
"Die Anekdote bringt das Andersartige und Übersehene zum Vorschein."
WELT am Sonntag, Marcus Woeller
"Für Kunstfreunde, die sich abseits von gängigen Katalogtexten in Leben und Werk vertiefen wollen, ist Buschs Buch ein Genuss."
Buchkultur, Holger Ehling
"Dieses Buch liest sich als überzeugendes Plädoyer für die Rekonstruktion des Orts der Kunst in der Geschichte."
Badisches Tagblatt, Kirsten Voigt
"Busch bietet eine Menge kunsthistorischer Gelehrsamkeit, die großteils mit Gewinn goutierbar ist, zumal sie in einer angenehm flüssigen, unprätentiösen Prosa präsentiert wird."
Landshuter Zeitung, Alexander Altmann
Süddeutsche Zeitung, Lothar Müller
"Busch (...) will die Anekdote nicht simpel als Hokuspokus entlarven, sondern verbindet sie elegant mit detailseliger Werkbetrachtung und Wirkungsgeschichte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit."
ZEIT, Alexander Cammann
"Sachkundig und stilsicher zeigt Werner Busch, wie solche Anekdoten ein Werk im kulturellen Raum verorten und theoretisch bestimmen. Davon profitiert nicht nur die Kunstgeschichte, sondern auch der auf Ordnung konditionierte Blick des Museumsbesuchers."
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kai Spanke
"Die Anekdote bringt das Andersartige und Übersehene zum Vorschein."
WELT am Sonntag, Marcus Woeller
"Für Kunstfreunde, die sich abseits von gängigen Katalogtexten in Leben und Werk vertiefen wollen, ist Buschs Buch ein Genuss."
Buchkultur, Holger Ehling
"Dieses Buch liest sich als überzeugendes Plädoyer für die Rekonstruktion des Orts der Kunst in der Geschichte."
Badisches Tagblatt, Kirsten Voigt
"Busch bietet eine Menge kunsthistorischer Gelehrsamkeit, die großteils mit Gewinn goutierbar ist, zumal sie in einer angenehm flüssigen, unprätentiösen Prosa präsentiert wird."
Landshuter Zeitung, Alexander Altmann