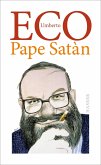Nach über zehn Jahren der neue Gedichtband von Raoul Schrott: eine Feier der großen Kleinigkeiten des Lebens. Geschrieben in meisterlicher Leichtigkeit, ist "Die Kunst an nichts zu glauben" ein Panorama des Allzumenschlichen. Die Gedichte werden von Sentenzen aus der ersten atheistischen Bibel gerahmt, dem "Manual der transitorischen Existenz" aus dem 17. Jahrhundert. Dazwischen stehen Portraits einzelner Berufstätiger, vom Busfahrer bis zum Richter. Sie alle stellen ihre Fragen nach dem Gelingen des Lebens und finden Schönheit im Scheitern. Gedichte und Sentenzen erzählen so grundverschiedene und doch gleiche Geschichten: vom Kampf um jeden irdischen Moment. Und wie er manchmal beglücken kann.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Nein, den Atheisten nimmt Rezensent Harald Hartung Raoul Schrott nicht ganz ab. Zu sehr raunt es metaphysisch in den Reflexionen und Gedichten in diesem Buch. Die Momentphilosophien des Autors zur Gottesfrage findet Hartung impressionistisch und zahm und insgesamt wenig überzeugend. Besser gefallen ihm Schrotts lyrische Versuche, wenngleich sie recht prosaisch daherkommen und Reimen als Sahnehäubchen bzw. Pfefferkörner begegnen. Den ganzen Klimbim um eine angeblich authentische obskure Schrift aus Ravennas Biblioteca Classense hätte sich der Autor jedenfalls sparen können, findet der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ein beinah frommer Atheist: Raoul Schrott übt sich dichtend in der "Kunst an nichts zu glauben".
Von Harald Hartung
Der Atheismus hat auch schon bessere Tage gesehen. Wer erinnert sich an die Zeit, da Arno Schmidt die Leser provozierte, als er sein "Atheist?: Allerdings!" heraustrompetete. Heute genügt das schlichte Bekenntnis zum tradierten Katholizismus, um das Schreckensbild des Ultramontanen zu erregen. Könnte es da nicht einen aufgeklärten Kopf verlocken, einen atheistischen Traktat zu schreiben? Raoul Schrott, als Autor, Übersetzer und Komparatist um Einfälle nie verlegen, könnte dieser Kopf sein. Sein neues Buch verspricht uns "Die Kunst an nichts zu glauben", setzt also voraus, dass der Unglaube keine einfache Sache ist. Schrott bietet für sein Unterfangen dreierlei auf: eine philologische Einführung, sodann Reflexionen und Gedichte im Wechsel.
In der Einleitung mutet uns Schrott einiges zu. Wenn er zu Anfang in den Mosaiken von Ravenna eine Bibel der Weltlichkeit sieht, erwartet man den Einstieg in die Atheismus-Frage. Dann traktiert er uns mit einem kuriosen philologischen Krimi. In Ravennas Biblioteca Classense will er auf die Schrift eines obskuren Matteo Cnuzen aus Pomposa gestoßen sein, auf das "Manuale Dell' Essistenza Transitoria (De Arte Nihil Credendi)". Doch ist das der Eintrag auf einer alten Karteikarte, nicht das Folio selbst. Was Schrott nicht hindert, später auf diesen offenkundig fingierten Cnuzen zurückzukommen.
Nicht fingiert, wenn auch nicht hilfreich, ist der Exkurs über den französischen Deisten Geoffroy Vallée, dessen Existenz - im Gegensatz zu derjenigen Cnuzens - nachweisbar ist. Vallée wurde wegen Gotteslästerung 1574 gehängt und anschließend verbrannt. Von ihm existiert ein Buch, das als "Ars nihil credendi (L'Art de ne croire en rien)" im achtzehnten Jahrhundert kursierte. Vallée ist der Strohmann, der den Fake "unseres Manuals" plausibel machen soll. Will sagen: Der Leser kann sich in der Kunst, an nichts zu glauben, schon ein wenig üben. Am ehesten wird er Schrott selbst als Verfasser in Betracht ziehen.
Ob der Autor seiner atheistischen Sache da einen Gefallen tut? Die Reflexionen stehen wie gedankliches Füllmaterial zwischen den Gedichten. Die Frage, ob die Notate aus antiquarischem Material kompiliert oder ad hoc geschrieben sind, muss den Leser schon nicht mehr plagen.
Manches operiert mit einer Art Momentphilosophie. Man liest Impressionen wie: "wir glauben zeit zu erleben: doch ist dies falsch. ein jeder erlebt nur momente - momente der erfahrung. schnipp mit den fingern: da ist ein bild - ein augenblick. schnipp sie erneut - und da ist wieder nur ein moment." Dann wieder raunt es: "rund um uns ist überall dunkle materie" oder "welt ist das worin keine kreatur zur ruhe findet." Das wirkt eher kontemplativ, man würde es nicht in einem atheistischen Brevier erwarten. Die wenigen Stellen, die von Gott handeln, sind zahm. So: "gäbe es gott müsste man ihn absetzen". Nietzsche lässt grüßen.
Durchaus lesenswert sind die Gedichte. Es macht nichts, dass der Autor den Vorsatz seines Titels vergessen hat. Denn es geht hier nicht um Atheismus, sondern um ein "gemeinschaftliches Gewissen", das sich in den Berufen und Werdegängen der Menschen darbiete. Schrotts Gedichte haben handfeste Titel wie "Die Fotografin", "Ein Straßenbauarbeiter", "Der Reisende", "Der Pizzabäcker", "Der Schlachter" oder "Die Ärztin". Titel, als habe der Autor den Ehrgeiz, an Fotos von August Sander zu erinnern. Schrott interessiert sich weniger für das Soziale als für das Bewusstsein, die Innenwelten seiner Protagonisten. Da differenziert er nach ihren intellektuellen und emotionalen Fähigkeiten. Der Forstarbeiter kommt zu dem Schluss: "leben ist auch fleiss. jeder macht sich sein eigenes gotterbarmen." Die Ärztin findet: "egal was man sagt - die ganze wahrheit ist keinem zumutbar." Schrott hat sogar Verständnis für die Probleme eines Pfarrers: "es ist ein loch in meinem herzen / durch das dieses sieche des menschlichen abrinnt."
Die Poesie, die Schrott seinen Porträts abgewinnt, ist prosaisch; prosaisch sind auch die Zeilen, die sich als Verse ausgeben. Die paar Reime sind Pfefferkörner. Die schon erwähnte Ärztin schließt mit dem Wunsch an ihren Partner: "nimm mich: nicht wie ich bin sondern wie ich gern wäre / küss mich. herz mich. nimm mir die erdenschwere." Da wird die erotische zur metaphysischen Wallung. Warum also sollte man Raoul Schrott nicht einen metaphysischen Poeten nennen und seine jüngste literarische Bemühung den Versuch, an etwas zu glauben?
Raoul Schrott: "Die Kunst an nichts zu glauben."
Hanser Verlag, München 2015. 168 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"...dieses so merkwürdige wie brillante Werk..." Claudia Mäder, NZZ am Sonntag, 29.12.15 "Schrott erweist sich abermals als der weltgewandte Philosoph unter den Poeten." Andreas Wirthensohn, Wiener Zeitung, 28.11.15 "Keiner beherrscht die Kunst, an nichts zu glauben. Aber Raoul Schrott beherrscht die Kunst, uns den Glauben an uns, an unser eigenes kleines Leben, zurückzugeben." Alexander Solloch, NDR Kultur "Neue Bücher", 09.10.15