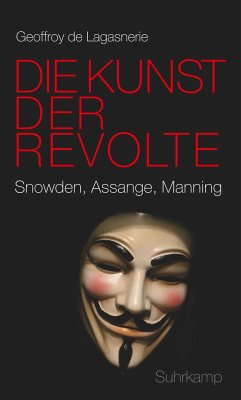Edward Snowden, Julian Assange und Chelsea Manning sind entscheidende Akteure in den zentralen Auseinandersetzungen unseres Internetzeitalters um Freiheit und Überwachung, Geheimdienste, Krieg und Terrorismus. Für den jungen französischen Philosophen Geoffroy de Lagasnerie sind sie aber noch mehr als das: Sie sind »exemplarische Figuren« einer neuen Kunst der Revolte, einer neuen Form des politischen Handelns und Subjektseins. Sein scharfsinniger Essay trifft ins Herz der Gegenwart.Das Prinzip der Anonymität, wie es WikiLeaks, aber auch die Hackergruppe Anonymous praktizieren, und die Gesten der Flucht und des Exils von Snowden und Assange brechen mit den traditionellen Formen des zivilen Ungehorsams. Sie fordern uns dazu auf, die demokratische Öffentlichkeit und den politischen Raum neu zu denken: Was bedeutet es heute, politisch das Wort zu ergreifen, ein Bürger, ein Teil eines Kollektivs zu sein? Mit ihren Aktionen formulieren diese Internetaktivisten und Hacker für de Lagasnerie nicht weniger als eine neue kritische Theorie und entwerfen ein Ideal der Emanzipation in pluralen, heterogenen und flüchtigen Gemeinschaften.

Flucht als Revolte: Für den französischen Philosophen Geoffroy de Lagasnerie eröffnen Edward Snowden, Julian Assange und Chelsea Manning ganz neue Formen der Politik
Knapp drei Jahre ist es nun her, dass Edward Snowden seine Enthüllungen über die staatliche Überwachungswut veröffentlicht hat - und dass der Schock dieser Erkenntnisse seitdem ziemlich überschaubare Wirkungen hatte, hat ganz unterschiedliche Gründe: Die einen tun, als hätten sie die ganze Sache immer schon gewusst, die anderen haben ihre Bedeutung noch immer nicht kapiert. Die einen fühlen sich in ihrer alltäglichen Freiheit kaum eingeschränkt, die anderen tauschen sie bereitwillig für das Versprechen der Sicherheit und halten Snowden für einen Verräter.
Die effektivste Möglichkeit aber, die Radikalität von Snowdens Enthüllungen zu verkennen, ist womöglich, ihn als Helden zu feiern. Mag sein, dass es Respekt verdient, wenn jemand seine Karriere für ein höheres Ziel aufgibt: Aber das gilt eben auch für jeden Selbstmordattentäter. Die politische Kraft von Snowdens Aktionen aber, so interpretiert es jedenfalls der französische Philosoph Geoffroy de Lagasnerie in seinem neuen Essay, verdankt sich weder seiner persönlichen Opferbereitschaft noch dem Inhalt seiner Enthüllungen. Sie liegt, wie bei anderen Whistleblowern auch, bei Julian Assange oder bei Chelsea Manning, im Aufzeigen einer "anderen Weise zu verstehen, was es bedeutet, Widerstand zu leisten". Man sollte diese Figuren daher, das ist die großartige Pointe des Buchs, nicht für ihren Mut bewundern. Sondern für ihre Feigheit.
Wer sich nämlich mit dem Lob ihres Muts begnügt, so argumentiert de Lagasnerie in "Die Kunst der Revolte", stellt den Kampf der Whistleblower in die "Kontinuität der großen demokratischen Kämpfe des 19. und 20. Jahrhunderts" und verkennt damit dessen revolutionären Charakter. Dabei wendet er sich vor allem gegen die Formel vom "zivilen Ungehorsam", mit der die Legitimität der illegalen Handlungen der Whistleblower gerne verteidigt werden. Ziviler Ungehorsam, so definiert es paradigmatisch John Rawls in seiner "Theorie der Gerechtigkeit", berufe sich immer auf die "gemeinsame Gerechtigkeitsvorstellung, die der politischen Ordnung zugrunde liegt". Er stellt daher, so de Lagasnerie, "keine Praxis der Anfechtung der Rechtsordnung dar". Der Ungehorsame handelt im Namen des Gesetzes, auch wenn er sich dabei im Einzelfall eher auf dessen Geist als auf die Buchstaben beruft. Sein Handeln ist somit im Grunde immer konservativ - es erkennt die Verfassung nicht nur an, sondern ratifiziert sie gewissermaßen noch: "Man könnte sogar in einem bestimmten Sinne sagen, dass die Dissidenten sich als gesetzestreuer verstehen als der Staat."
Dass es sich bei Snowden, Assange, Manning nicht um solche Vorzeigedemokraten handelt, um Idealisten, die auf die Ungerechtigkeit der herrschenden Gesetzesbrecher hinweisen, macht de Lagasnerie an einem Punkt fest, den man leicht für einen belanglosen Zufall halten könnte: die Tatsache, dass sie sich den Gesetzen ihres Landes entziehen. Snowden und Assange wählten das Asyl, auch Manning hat sich nicht freiwillig gestellt. Dafür, dass sie ihre Bestrafung nicht akzeptieren, wie es sich für einen amtlichen Dissidenten gehören würde, werden sie oft sogar von Sympathisanten ihrer Sache kritisiert. Für seine Handlungen einzustehen nämlich gehört zu den Bedingungen des "zivilen Ungehorsams". Schon Henry David Thoreau schrieb in "Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat" vom "freieren und ehrbareren Boden" des Gefängnisses: "Es ist das einzige Haus in einem Sklavenstaat, das ein freier Mann in Ehren bewohnen kann."
Snowden und Assange dagegen hätten sich als ",unverantwortliche' Subjekte gezeigt, die sich weigern, vor Gericht zu erscheinen", schreibt de Lagasnerie - und meint das durchaus positiv. Und zeigt, wie problematisch die weithin akzeptierte Vorstellung ist, politisches Engagement müsse mit einem Risiko verbunden sein und Dissens mit einem Opfer. Die Floskel, jemand müsse für seine Überzeugungen eintreten, ist dabei nur die pathetische Ausprägung eines Demokratieverständnisses, das politisches Handeln grundsätzlich nur als sichtbares Bekenntnis akzeptiert, als öffentliche Rede, als Äußerung einer Meinung, als Demonstration einer Haltung - Politik, die immer mit Identifikation verbunden ist und selbst die stumme Praxis der Wahl noch als Abgabe der "Stimme" bezeichnet. Gegen diese Rhetorik bringt de Lagasnerie die Anonymität ins Spiel, als Möglichkeit, politisches Handeln in einer Form zu artikulieren, die die Subjekte von der Notwendigkeit (und dem Risiko) befreit, identifizierbar zu sein. Anonyme Plattformen wie Wikileaks, vor allem aber ein Kollektiv wie Anonymous, dessen Mitglieder durch ihre Aktionen weder berühmt noch zur Verantwortung gezogen wurden, stellen die Instrumente einer solchen Politik zur Verfügung.
Dass Snowden, im Gegensatz zu Assange, mehrfach seine Bereitschaft signalisiert hat, in ein amerikanisches Gefängnis zu gehen, ändert für de Lagasnerie nichts an der Perspektive, welche die Praxis des Exils öffnet. In der Zurückweisung der Legitimität einer willkürlichen Gemeinschaft besteht für ihn das neue Element politischen Handelns, die "Kunst der Revolte" der Whistleblower: Indem sie sich der nationalen Gerichtsbarkeit entziehen, weisen sie auf ein grundlegendes Problem jeder nationalstaatlichen Rechtsordnung hin, auf ein Grundübel der Konstitution von Gesellschaften, an dem auch die fiktiven Verträge nichts ändern können, die seit ein paar Jahrhunderten helfen, demokratische Gemeinschaften zu begründen: die Tatsache, dass wir zum Staat gezwungen werden. "Die Gewalt des Staates", schreibt de Lagasnerie, "wurzelt in der Tatsache, dass man zwangsläufig in ihn eintreten muss und dass es unmöglich ist, aus ihm herauszukommen. Der Staat lässt uns nie die Wahl (. . .) Wir sind eingeschlossen."
Die Vision, die mit der Kritik solcher erzwungenen Identitäten verbunden ist, die Zurückweisung der Gewalt willkürlicher Zusammenschlüsse, die die Namen einer Nation, einer Rasse, einer Religion tragen, kennt man spätestens seit der Postmoderne. Und so problematisch das Idyll solcher Communitys auch sein mag, die sich an selbstgewählten Gemeinsamkeiten orientieren und sich damit auch immer von der Idee der Solidarität mit Ausgeschlossenen verabschieden, so wichtig ist es, dass de Lagasnerie angesichts der Rückkehr identitärer Appelle ihre Aktualität in Erinnerung ruft. In Zeiten, in denen Flucht immer noch, wenn nicht als Verbrechen, so doch prinzipiell als unfreiwilliges Schicksal betrachtet wird, sollte man sich vielleicht die Frage stellen, ob man die Entscheidung, sein Land zu verlassen, nicht völlig anders interpretieren muss: als Zurückweisung der Zugehörigkeit zu einer zufälligen Zwangsgemeinschaft, als Akt der Revolte, als "eine Art von Staatsstreich", wie Geoffroy de Lagasnerie schreibt.
Nicht immer ist der Zusammenbruch eines Staates der Grund, vor ihm zu fliehen. Manchmal ist es einfach sein Funktionieren.
HARALD STAUN.
Geoffroy de Lagasnerie: "Die Kunst der Revolte. Snowden, Assange, Manning". Suhrkamp, 158 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Sehr viel Platz nimmt sich Marie Schmidt, um ein Buch zu besprechen, an dessen intellektueller Schlagkraft sie offenbar mehr als zweifelt. Geoffroy de Lagasnerie schildert sie glaubhaft als groß tönenden, aber schlampig argumentierenden Jung-Intellektuellen, der in den Whistlebowern Edward Snowden, Chelsea Manning und Julian Assange Symbolfiguren einer neuen, indivdiduell agierenden Revolte erkennt. Lagasneries Idee eines Bruchs mit einem Staat, dessen Bürger man qua Geburt - also nicht freiwillig - geworden sei, nennt sie zugleich brandgefährlich und verführerisch. Mit Lagasneries schnarrend linksradikal vorgetragenen "Performance eines Engagements", die an die argumentative Präzision der Vorbilder Michel Foucaults oder Pierre Bourdieus nicht im entferntesten heranreiche, kann Marie Schmidt nichts anfangen - und dann doch wieder, denn sonst würde sie das Buch ja wohl nicht auf eine ganzen Zeit-Seite besprechen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Geoffroy de Lagasnerie schafft es, auf 160 bestens lesbaren, spannenden Seiten das politische Denken neu auszurichten.« Gert Scobel Philosophie Magazin 20160317