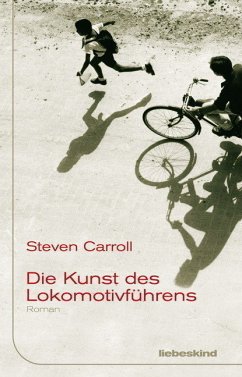Anfang der fünfziger Jahre in einem Vorort von Melbourne: An einem warmen Sommerabend gehen Vic, Rita und ihr Sohn Michael die Straße hinunter zum Haus von George Bedser, der die ganze Nachbarschaft zur Verlobungsfeier seiner Tochter eingeladen hat. Vic ist Lokomotivführer und träumt vom »Big Wheel«, davon, die großen Personenzüge zu führen, genau wie sein Lehrmeister Paddy Ryan, der in diesem Moment auf der Strecke nach Sydney ein Haltesignal überfährt und seine Passagiere in Lebensgefahr bringt. Es wird langsam dunkel, und am Ende der Straße, unweit vom Haus der Bedsers, taucht ein schwarzer Wagen auf. Patsy Bedsers heimlicher Geliebter Jimmy ist gekommen, um den Verlobten zu gratulieren und Patsy ein letztes Malzu sehen, bevor er das Land verläßt. Als er endlich den Mut findet, das Haus zu betreten, haben sich Vic, Rita und Michael schon längst unter die Partygäste gemischt, und Paddy Ryan hat sein zweites Haltesignal überfahren. Keiner der Anwesenden ahnt, daß die heutige Nacht sein Leben für immer verändern wird.

Steven Carroll besingt die Kunst des Lokomotivführens
In einem Land, in dem die beiden größten Städte siebenhundert Kilometer voneinander entfernt liegen und die anderen noch viel weiter, sind die Flugplätze wichtiger als die Bahnhöfe. Der Nimbus, der die beiden rußverschmierten und kohleschaufelnden Männer in Overalls auf den schweren Lokomotiven umgab, ist längst auf die schmucken Flugkapitäne übergegangen, denn durch sie schmilzt die tag- oder nachtlange Reise zwischen Melbourne und Sydney auf eine Stunde zusammen. Von der Kunst des Lokomotivführens zu erzählen, wie das der Australier Steven Carroll getan hat, heißt also eigentlich von einer guten alten Zeit zu berichten.
In dieser aber bedeutete solche Kunst, "all die Zahlen und Instrumente" zu vergessen und statt dessen ein Fluidum, ein Bauchgefühl zu besitzen: "Natürlich kannst du ganz nach Vorschrift fahren, man kann die Kurven und abfallenden Strecken mit vorgeschriebener Geschwindigkeit nehmen, dann kommst du pünktlich an, und alle werden dich für einen guten Lokführer halten. Aber ein großer fährt mit Fingerspitzen und Armen, mit Schultern, Bauch und Nacken, mit Eingeweiden und Zehen. Der braucht keine Instrumente, sein Körper ist voll von ihnen."
So jedenfalls sieht es Vic, der Eisenbahner. Nur sollte er wohl überhaupt keine Züge fahren, denn er ist Alkoholiker und leidet zudem - dies wird von Carroll ausführlich beschrieben - an Epilepsie. Vics bewundertes Musterbild als Künstler auf der Lokomotive ist Paddy Ryan, "der Michelangelo unter den Lokführern", der die großen Überlandpersonenzüge, die "Big Wheels", leiten darf. Bloß ist er herzkrank, weshalb er denn bei der Ausübung seiner Kunst einen Infarkt bekommt und deshalb mit dem modernen "Spirit of Progress" zahlreiche Menschen in den Tod fährt, was übrigens 1943 unter ähnlichen Umständen tatsächlich geschah.
Aber auch ohne Eisenbahn erführe man dies aus dem, was Carroll sonst noch zu erzählen hat. Es ist die Geschichte eines Tages im Leben der Leute einer kleinen Siedlung am Rande von Melbourne, die nach und nach von der Großstadt geschluckt werden wird. An diesem Samstag verlobt sich Padsy Bedser mit dem Klempner, den sie am nächsten Tag dann doch verlassen wird. Jetzt jedoch ist der ganze Ort erst einmal zur Feier eingeladen. Und nun kommen sie alle, Vic und Rita, Peter van Rijn, der dem Ort das Fernsehen gebracht hat und dem sie dann doch die Schaufensterscheiben eingeschlagen haben, Malek, der alte Pole, der nur wenig Englisch kann und ein Sonderling ist, und all die anderen, die Youngers, Bedsers, Buchners, Millers. Jeder schleppt seine Geschichte mit sich herum, monologisiert vor sich hin, so daß wir ein bißchen mithören können, wie es innen aussieht. Das Resultat ähnelt der Weisheit über das Lokfahren: Am Ende ist es eben doch nichts mit der Kunst des einfachen Lebens.
Rita bleibt allerdings bei Vic, wenigstens vorerst und aus Solidarität. Denn nach dem Bahnunglück wird man alle Lokomotivführer überprüfen, und der kranke Vic dürfte dann keine Chance mehr haben. Ganz ohne Trost läßt Carroll seine Leserschaft indes nicht: Ein Komet steht über dem Land, und Hoffnung wird bei Michael sein, dem verständigen, liebevollen zwölfjährigen Sohn von Vic und Rita, für den der Rausch der Geschwindigkeit sich vorwiegend im Schuß des Kricket-Balls manifestiert. Carroll hat seinen nächsten Roman über ihn und die schnellen Bälle geschrieben. Schließlich ist Australien das Land, in dem Sport die am hingebungsvollsten praktizierte Religion ist.
Carroll zeigt, das sei zu seinem Lobe gesagt, ein Australien ohne Känguruhs, Krokodile und Koalabären. Die Menschen sind ganz gewöhnliche Menschen wie anderswo auch. Ein wenig Spaß wollen sie haben, und wie anderswo auch wissen sie nicht, wie und warum sie einander daran hindern. Leider verschenkt Carroll manche Motive, die er umständlich eingeführt hat, das der Epilepsie zum Beispiel; sein Spiel mit den Zeitebenen ist zuweilen recht ungeschickt. Paddy Ryans Tod samt seinen verheerenden Folgen widerlegt im übrigen auch eigentlich nicht die Kunst des Lokomotivführens, sondern erweist lediglich die Nachlässigkeiten der Victorian Railways, die sich damals offenbar um die Gesundheit ihres Personals nur wenig scherten. Inzwischen hat man von den Flugkapitänen gelernt, auf die ja hinsichtlich ihrer Fitness bekanntlich besser aufgepaßt wird.
GERHARD SCHULZ
Steven Carroll: "Die Kunst des Lokomotivführens". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Peter Torberg. Verlagsbuchhandlung Liebeskind, München 2006. 269 S., geb., 19,80 [Euro] .
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Steven Caroll beschreibe das Leben ganz normaler Menschen in einem ganz normalen Vorort von Melbourne, skizziert Rezensent Gerhald Schulz den Plot, und zwar anhand eines schönen Tages, an dem Padsy sich mit dem Klempner verlobt. Innerhalb der vielen Lebensgeschichten der vielen Feiergäste stehe allerdings Vic, der Eisenbahner, im Vordergrund, samt seiner höheren Philosophie des Eisenbahnfahrens. Ausdrücklich lobend erwähnt der Rezensent an dieser Stelle, dass der Autor alle bekannten Formen von australischer Folklore wie Känguruhs oder Koalabären außen vor lässt. Leider aber "verschenke" der Autor mitunter so schöne Motive wie das der Epilepsie von Vic, und auch bei den verschiedenen Zeitebenen habe er kein glückliches Händchen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH