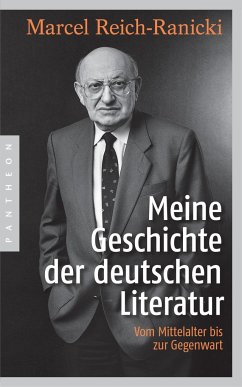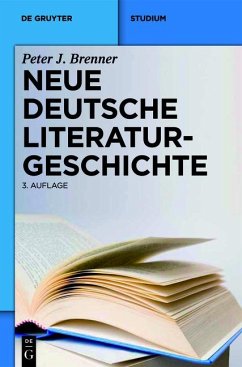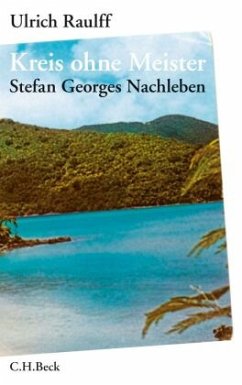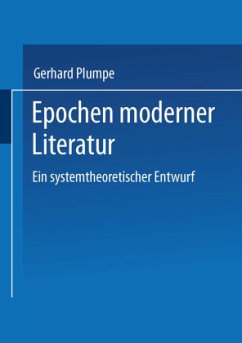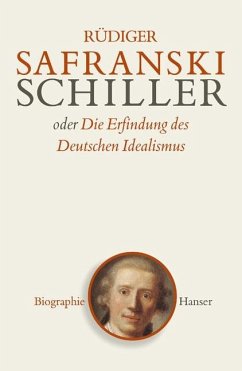Die kurze Geschichte der deutschen Literatur
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
20,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Erst von 1750 an - lange also nach den klassischen Epochen der italienischen, spanischen oder französischen Literatur - entstehen in Deutschland Werke, die zur Weltliteratur zählen: die Literatur des klassisch-romantischen Zeitalters.
In diesem Buch geht Heinz Schlaffer den Gründen für die Verspätung und für die kurze Dauer der glücklichen Konstellation nach. Gedanke und Stil verbinden sich in dieser provokativen Literaturgeschichte - die vom Mittelalter bis zur Gegenwart reicht - so, dass die Fachleute zum Nachdenken über verdrängte Fragen bewegt werden, die Liebhaber aber zu neuer Beschäftigung mit den eigenwilligen und fast schon vergessenen Leistungen der deutschen Literatur. Für sie vor allem ist dieses Buch geschrieben.
In diesem Buch geht Heinz Schlaffer den Gründen für die Verspätung und für die kurze Dauer der glücklichen Konstellation nach. Gedanke und Stil verbinden sich in dieser provokativen Literaturgeschichte - die vom Mittelalter bis zur Gegenwart reicht - so, dass die Fachleute zum Nachdenken über verdrängte Fragen bewegt werden, die Liebhaber aber zu neuer Beschäftigung mit den eigenwilligen und fast schon vergessenen Leistungen der deutschen Literatur. Für sie vor allem ist dieses Buch geschrieben.
Was ist an deutscher Literatur eigentlich "deutsch"? An dieser Frage orientiert sich diese scharf argumentierende, anschaulich formulierte Literaturgeschichte, von den Anfängen deutscher Dichtung bis zur Gegenwart. Das Buch meidet Terminologien, mit denen die heutige Literaturwissenschaft dem Laien das bessere Verständnis verwehrt und vermittelt gleichzeitig neue Einsichten in den inneren Zusammenhang der deutschen Literatur.