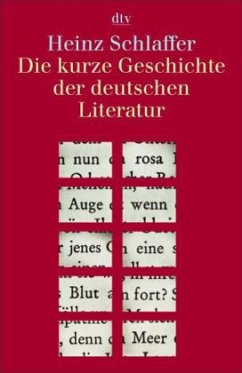Was ist deutsch an der deutschen Literatur? Gibt es tatsächlich eine kontinuierliche deutsche Literaturgeschichte vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart? Heinz Schlaffer geht diesen Fragen nach und kommt zu überraschenden Ergebnissen.
Erst von 1750 an - lange nach den klassischen Epochen der italienischen, französischen oder englischen Literatur - gibt es in Deutschland Werke, die zur Weltliteratur zählen. Als späte Auswirkung der Sprache der Mystik, der Reformation Luthers und der Aufklärung entsteht die Literatur der klassisch-romantischen Epoche - eine Blütezeit von rund achtzig Jahren, gefolgt von einer zweiten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hauptgrund für diesen verspäteten Eintritt in die Weltliteratur ist, dass in Deutschland »das Mittelalter nicht enden wollte«.
Provokant, geistreich und stilistisch brillant vermittelt Schlaffer gänzlich neue Einsichten in die Geschichte der deutschen Literatur, die die bisherigen Erkenntnisse der Germanistikgehörig auf den Kopf stellen.
Erst von 1750 an - lange nach den klassischen Epochen der italienischen, französischen oder englischen Literatur - gibt es in Deutschland Werke, die zur Weltliteratur zählen. Als späte Auswirkung der Sprache der Mystik, der Reformation Luthers und der Aufklärung entsteht die Literatur der klassisch-romantischen Epoche - eine Blütezeit von rund achtzig Jahren, gefolgt von einer zweiten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hauptgrund für diesen verspäteten Eintritt in die Weltliteratur ist, dass in Deutschland »das Mittelalter nicht enden wollte«.
Provokant, geistreich und stilistisch brillant vermittelt Schlaffer gänzlich neue Einsichten in die Geschichte der deutschen Literatur, die die bisherigen Erkenntnisse der Germanistikgehörig auf den Kopf stellen.

Einstürzende Altbauten, Abriß der Moderne: Heinz Schlaffers Literaturgeschichte / Von Hans-Jürgen Schings
Womöglich haben wir einen neuen Faust. Sein "Habe nun, ach!" richtet sich auf die Geschichte der deutschen Literatur. Der Germanistikprofessor Heinz Schlaffer blickt zurück auf zwölfhundert Jahre und stellt fest: Eigentlich zählen da nur die von 1770 bis 1830 und die von 1900 bis 1950. Danach ist Schluß, davor gibt es nur Kauderwelsch, formalistischen Pomp oder eine künstlich hergerichtete, "germanistische" Literaturgeschichte. Anders als sein Vorgänger verzweifelt dieser Faust nicht, er evaluiert. Und die Evaluation ist denkbar erfolgreich: Über eintausend Jahre können eingespart werden. Das Ressentiment, stets zur Stelle, wenn es der Germanistik eins auszuwischen gilt, jauchzte reklamewirksam auf, ehe das Büchlein überhaupt auf den Markt kam.
Das Unternehmen "Kurzer Prozeß" versteckt sich hinter dem listigen Titel "Die kurze Geschichte der deutschen Literatur". Ohne den bestimmten Artikel hätte nun tatsächlich so etwas wie eine Literaturgeschichte geschrieben werden müssen. Das kann mühsam sein. Hier dagegen handelt es sich um einen Essay über die Kürze der deutschen Literatur, der aus diesem Befund gleich auch das Privileg der eigenen Kürze zieht und die eingesparte Mühe in die "Anstrengung, besonders zu sein" (Wilhelm Grimm), investiert. Das Resultat ist aufgeräumte Kurzweiligkeit, ein Feuerwerk an Pointen, das den amüsierten Leser gleich auch auf Gutgläubigkeit einstimmt. Da prasselt es: "Die Ausgrabungen der Germanisten sind lediglich Umbettungen: von den Bibliotheken . . . wieder zurück in die ewige Ruhe der Bibliotheken - unter Umgehung der Leser." "Viel wird geforscht, wenig gelesen." "In Deutschland hat die Mitwelt meistens die falschen Bücher gelesen." "Man liest gerne etwas über das Mittelalter . . ., doch nicht gerne etwas aus dem Mittelalter." Bis zum Schlußsatz: "Die kurze Geschichte der deutschen Literatur ist so kurz, daß dem Leser Zeit bleibt, sich wieder der deutschen Literatur zuzuwenden, der dieses Buch sein Dasein verdankt." Zuvor allerdings wird er sich fragen, ob er, trotz der verlockenden Sparangebote, mehr als eine Sammlung von Aperçus gelesen hat.
Immerhin erfährt man, was deutsche Literatur ausmacht: umgewandelte religiöse, christliche Energie. Was also benötigt sie zu ihrer Entstehung? Nicht zu wenige protestantische Pfarrersöhne als personales und soziales Substrat, viel Pietismus als umformbare religiöse und sprachliche Masse und eine gehörige Portion Aufklärung, möglichst von der radikalen Sorte, die die Energietransformation, sprich Säkularisation, erzwingt. Daß diese Konstellation für die Literatur des achtzehnten Jahrhunderts fruchtbar ist, haben Herbert Schöffler und Albrecht Schöne längst und im Detail gezeigt. Zwar fehlt ausgerechnet Goethe das Merkmal Pfarrersohn, doch macht das sein "Werther" mehr als wett; er enthält für Schlaffer die ganze Geschichte der deutschen Literatur, mit Vergangenheit und Zukunft, von der Passionsangleichung bis zum Abschied vom Christentum, bis zum ketzerisch neuen "Evangelium der Natur, der Kunst, der Liebe".
Was diesem Evangelium gehorcht, bildet monumental die große deutsche Literatur der klassisch-romantischen Periode; was nie von ihm gehört hat, findet seinen Platz allenfalls in den Werkstätten der germanistischen Literaturgeschichte, die der "gebildete Leser", Schlaffers Lieblingsinstanz, getrost meidet. Unversehens wird aus der einzigartigen literarhistorischen Lage der Werther-Zeit ein normatives Modell, wird aus dem Andersartigen das Abartige. Besonders hart trifft es dabei den Zeitraum vom vierzehnten bis zum Beginn des achtzehnten Jahrhunderts, die frühe Neuzeit: Er ist schlechterdings "unbedeutend" und könnte fehlen, ohne daß sonderlich Schaden entstünde. Auffällig ist der vorwurfsvolle Ton, den Schlaffer anschlägt, als hätten fehlende Leser, das schwache nachmittelalterliche Gedächtnis, die Kämpfe der Reformation und der Dreißigjährige Krieg, rückständige Autoren und vor allem seine Berufskollegen ihn persönlich gekränkt. Indigniert weicht er deshalb vor allem zurück, was Curtius selbst in der Germanistik eingebürgert hatte. Es geht wieder ohne die lateinische Tradition, das Neulateinische, die Rhetorik, den Manierismus. Nur ein paar Kirchenlieder und Grimmelshausen können sich in die Arche der deutschen Literatur retten. Statt "Barock" (Achtung, der Name ist ein Täuschungsmanöver) sollte man "Formalismus" sagen (wo hat man das zuletzt gehört?), um das "versäumte siebzehnte Jahrhundert" (Helmuth Plessner) vollends zu eliminieren.
Über eigene Lektüren berichtet die "Kurze Geschichte" ungern, wohl aber hat sie Phantasien über "denkbare" Dichtung in trostloser Zeit parat. Gibt es doch selbst im Mittelalter "religiöse Züge" und "frommen Ernst", vor allem aber, und dies in der Volkssprache, mystische Spiritualität. Da deutet sich immerhin der deutsch-pietistisch-literarische Komplex an, gar eine Tradition, was ausnahmsweise auch belegt wird: "So erscheint 1703 im Umkreis des Hallenser Pietisten Spener eine Ausgabe von Taulers Predigten." Wackliger kann kein literarhistorischer Satz daherkommen - nichts stimmt: weder die Jahreszahl noch der "Umkreis", noch der Hallenser Spener. Ein Pietismus-Kenner scheint unser Theoretiker des literaturstiftenden Pietismus nicht zu sein. Dafür weiß er, wie man aus der Mystik Meister Eckharts hätte Literatur machen können: "durch die ironische Brechung der Bilder, durch eine ästhetische Reflexion auf die Kunstmittel, durch die Zerstörung literarischer Erwartungen, durch das Aussprechen von Ideen in Begriffen" und so fort, also durch russischen Formalismus, Goethesche Symbolik und moderne Ausdruckskunst.
Im Fluge ist dieser Literarhistoriker dann nicht bei den mystischen Literaten des siebzehnten Jahrhunderts, sondern bei Jean Pauls bekanntem Wort von dem durch das Christentum bewirkten Einsturz der äußeren Welt in die innere und der Folgerung, daß es nur noch "des Einsturzes der christlichen Welt" bedurfte, "damit ihre poetischen Möglichkeiten uneingeschränkt dem poetischen Geist zur Verfügung stehen konnten". Eher wecken die beiden Seiten, auf denen dies alles geschieht, die Furcht vor dem einstürzenden Neubau der "Kurzen Geschichte". Kein Wunder, daß deren Liaison mit dem Pietismus auch später skurrile Züge annimmt. Da sie sich paradigmatisch auf die Metaphorik des Wassers beruft, gilt: Wo Wasser ist, da ist auch säkularisierter Pietismus, und mithin: "Kommt unter den Dichtern seit der Mitte des 18. Jahrhunderts das Schwimmen in Mode, so hat daran die mystische Metapher des Wassers ebenso mitgewirkt wie das Bedürfnis, lyrische Wörter im Leben zu bewahrheiten." Und wie steht es, mit Verlaub, mit dem Schlittschuhlaufen?
Man sollte annehmen, daß nach dem endlich "geglückten Anfang" um 1770 bessere Zeiten aufziehen. Doch nachdem das Buch sein vormodernes Kürzungsprogramm erledigt hat, macht sich ein anderes Genre der Kürze geltend, die Kurzatmigkeit. Rasch gleiten jetzt die üblichen Topoi vorbei: stürmisch-drängende Jugendlichkeit und Studentenherrlichkeit (in diese Rubrik gehört Faust), Seelenausdruck und Genie, Innerlichkeit und deutsche Tiefe (vom romantischen Bergbau bis zu Freuds Archäologie und zur Hermeneutik), Antikensehnsucht, Klassik (die es freilich nie gegeben habe), Autonomie (auch sie eine Illusion, die nur die "dubiose Vorgeschichte" der entlaufenen Pfarrersöhne verdeckt). Fahrt nimmt der Essay erst wieder auf, wenn er der neuen Kunstreligion die Überschreitung ihres "Zuständigkeitsbereichs" ankreiden kann. "Die unsterbliche Poesie" - wird deshalb also in der deutschen Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts so "viel geschwebt"? Die "Verstrickung" der "von Hause aus protestantischen Romantik in eine katholische Mythologie" paßt sowenig in den Thesenrahmen, daß sie auf wenigen Zeilen abgetan wird. Nein, wirklich zufrieden ist die "Kurze Geschichte" auch mit ihrer Blütezeit nicht.
Das neunzehnte Jahrhundert ist die karge Zeit der Epigonen - da bleiben nur Keller und Fontane und, als eigentliches Zentrum, Büchner und Marx; Schopenhauer und Nietzsche werden durch Nichtbeachtung gestraft. Um so plötzlicher erfolgt der neue Aufstieg, der "Auftritt der Moderne", mit katholischen und jüdischen Autoren. Jetzt muß die Säkularisationsthese zaubern, damit sich eine genaue Analogie zum ersten Erfolgsschub zeigt, und sie tut es: die modernen Autoren, gleich welcher Provenienz, katholisch zurückgeblieben nach Art bayerischer Bauernsöhne oder assimiliert und bildungsbeflissen wie die jüdischen Eliten, treten kurzerhand zum "literarischen Protestantismus" über, landen also mit ihren religiösen Restenergien dort, wo die deutsche Literatur nun einmal hingehört. Sie bevorzugen das Thema Untergang, was aber nichts anderes besagt, als daß sich "die große deutsche Vergangenheit" nicht "in die Gegenwart" retten läßt. Die Katastrophe der Juden beendet die "klassische Moderne" - ab 1950 kommt eigentlich, abgesehen vielleicht von ein paar sektiererischen Außenseitern, einseitigen Formexperimentierern und besonderen Schützlingen der Germanistik (wie Paul Celan), nichts mehr. Den Autoren in West und Ost wird ausgerechnet ihr "Protestantismus" zum Verhängnis, der Status des Bußpredigers, der immer "für das Gute" ist, die politische Korrektheit, die eine "Freiheit des poetischen Zynismus" verbietet. Unwirsch und freudlos klingt die "Kurze Geschichte" aus. Sie entledigt sich ihres Gegenstandes, um gerade noch zur Lektüre ihrer selbst einzuladen. So fügt sie der nicht immer glücklichen Geschichte der deutschen Literatur ein weiteres kleines Malheur hinzu, eine germanistische Fußnote allerdings nur. Und gewiß eine kurze.
Heinz Schlaffer: "Die kurze Geschichte der deutschen Literatur". Hanser Verlag, München und Wien 2002. 158 S., geb., 12,90
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"So elegant er in seiner Polemik den Einmann-Abbruchunternehmer spielt, so nüchtern er klarstellt, dass mit dem Verdämmern der Klassiker auch das Ende echter Belesenheit gekommen sein dürfte: Im Grunde hängt Schlaffer viel zu sehr an der großen Literatur, als dass er auf sie verzichten könnte. Sein brillantes Büchlein, als cool-nostalgische 'Flaschenpost' in den Strom der Zeit geworfen, zeigt es auf jeder Seite - zwischen den Zeilen: Eigentlich, ganz eigentlich hätte Heinz Schlaffer wohl am liebsten Unrecht." DER SPIEGEL
"Es singen die Wasser im Schlafe noch fort, wohl wahr, aber man sollte sie ruhig hin und wieder mal aufwecken. Heinz Schlaffer hat es getan. Er hat es kurz und gut gemacht. Er lässt uns, indem er unsere Aufmerksamkeit dankenswerterweise nicht mit einem Tausend-Seiten-Opus okkupiert, sondern uns ein leicht verdauliches amuse-gueule zuwirft, Zeit, sie uns zurückzuerobern, jene deutsche Literatur der inneren Dringlichkeit, die auch für diejenigen, die meinen, auf sie verzichten zu können, bereit hält, in der Fülle des Wohllauts, was wir uns insgeheim alle wünschen: Freiheit und Glück." DIE WELT
"Lässig schwingt Schlaffer das Stöckchen des geübten Causeurs, und seine zarten, gut gezielten Streiche treffen germanistische Traditionen wie Gepflogenheiten des bürgerlichen Theaterbesuches, die spezifische Untergangsverliebtheit deutschsprachiger Avantgarde wie die Dauerbereitschaft zum Sprachverbot und das Gewürge ums 'Deutschsein'." Stuttgarter Zeitung
"Mit der Respektlosigkeit des klarsichtigen Forschers beschreibt Schlaffer eine Geschichte von Fremdeinflüssen und verlorenen Anfängen, von Abbrüchen und Neuanfängen, von einer diffusen langen Vorgeschichte und einem ersten Höhepunkt auf Weltliteraturniveau um 1770 bis 1830, gefolgt von einer kurzen 'Nachgeschichte' mit einem erneuten Höhepunkt von 1900 bis 1950, und dann, behauptet Schlaffer, war Schluss. Eine 'kurze Geschichte' eben. ... Wirkungsvoll genug: das Deutsche an der deutschen Literatur ist für einmal gedacht worden." Cord Barkhausen in der 'ZEIT'
"Die Betonung liegt auf deutsch, und deutsch ist die Verbindung von Pietismus und Antike, wie sie in der Klassik zum Ausdruck kam. In einer nachholenden Bewegung wurde so die deutsche Literatur, die zuvor nur eine schwächliche Nachahmung fremder Muster zustande gebracht hatte, zur Weltliteratur. Zwar hat Schlaffer leichte Probleme, die katholischen Romantiker und jüdischen Österreicher seiner Definition unterzuordnen, aber der glänzend geschriebene Essay hat den Vorzug, aus einer unhaltbaren These haltbare Einsichten zu gewinnen." Ulrich Greiner in der 'ZEIT'
"Erst jetzt, nachdem einer der großen Philologen im Lande gegen den antiquarischen Geist seines Faches zu Felde gezogen ist, erkennen wir, wie staubtrocken und schwach die historisch-philologischen Disziplinen geworden sind. Und bitten jetzt, der polemische Essayist, der den Staub der Germanistik aufwirbelt, möge Nachahmer in anderen Fächern finden. Man stelle sich vor: ein Buch wie dieses aus der Mitte der Historie oder der Philosophie - nicht auszudenken, das Glück." Ulrich Raulff in der 'Süddeutschen Zeitung'
"Mit trotzigem Freimut bekennt Schlaffer sich zur 'radikalen Aufklärung'. Einer solchen sind in der deutschen Literatur aber beinahe ausschließlich Geister zweiten Ranges zuzurechnen. Das erklärt vielleicht Schlaffers Frustration als Germanist. Es mag ihm mit der Germanistik gehen wie Prousts Monsieur Swann mit seiner einstigen Liebe Odette, als er erkennt, dass er seine ganze Leidenschaft für eine Frau verschwendet hat, 'die nicht sein Genre war'." Martin Mosebach in der 'Süddeutschen Zeitung'
"Es singen die Wasser im Schlafe noch fort, wohl wahr, aber man sollte sie ruhig hin und wieder mal aufwecken. Heinz Schlaffer hat es getan. Er hat es kurz und gut gemacht. Er lässt uns, indem er unsere Aufmerksamkeit dankenswerterweise nicht mit einem Tausend-Seiten-Opus okkupiert, sondern uns ein leicht verdauliches amuse-gueule zuwirft, Zeit, sie uns zurückzuerobern, jene deutsche Literatur der inneren Dringlichkeit, die auch für diejenigen, die meinen, auf sie verzichten zu können, bereit hält, in der Fülle des Wohllauts, was wir uns insgeheim alle wünschen: Freiheit und Glück." DIE WELT
"Lässig schwingt Schlaffer das Stöckchen des geübten Causeurs, und seine zarten, gut gezielten Streiche treffen germanistische Traditionen wie Gepflogenheiten des bürgerlichen Theaterbesuches, die spezifische Untergangsverliebtheit deutschsprachiger Avantgarde wie die Dauerbereitschaft zum Sprachverbot und das Gewürge ums 'Deutschsein'." Stuttgarter Zeitung
"Mit der Respektlosigkeit des klarsichtigen Forschers beschreibt Schlaffer eine Geschichte von Fremdeinflüssen und verlorenen Anfängen, von Abbrüchen und Neuanfängen, von einer diffusen langen Vorgeschichte und einem ersten Höhepunkt auf Weltliteraturniveau um 1770 bis 1830, gefolgt von einer kurzen 'Nachgeschichte' mit einem erneuten Höhepunkt von 1900 bis 1950, und dann, behauptet Schlaffer, war Schluss. Eine 'kurze Geschichte' eben. ... Wirkungsvoll genug: das Deutsche an der deutschen Literatur ist für einmal gedacht worden." Cord Barkhausen in der 'ZEIT'
"Die Betonung liegt auf deutsch, und deutsch ist die Verbindung von Pietismus und Antike, wie sie in der Klassik zum Ausdruck kam. In einer nachholenden Bewegung wurde so die deutsche Literatur, die zuvor nur eine schwächliche Nachahmung fremder Muster zustande gebracht hatte, zur Weltliteratur. Zwar hat Schlaffer leichte Probleme, die katholischen Romantiker und jüdischen Österreicher seiner Definition unterzuordnen, aber der glänzend geschriebene Essay hat den Vorzug, aus einer unhaltbaren These haltbare Einsichten zu gewinnen." Ulrich Greiner in der 'ZEIT'
"Erst jetzt, nachdem einer der großen Philologen im Lande gegen den antiquarischen Geist seines Faches zu Felde gezogen ist, erkennen wir, wie staubtrocken und schwach die historisch-philologischen Disziplinen geworden sind. Und bitten jetzt, der polemische Essayist, der den Staub der Germanistik aufwirbelt, möge Nachahmer in anderen Fächern finden. Man stelle sich vor: ein Buch wie dieses aus der Mitte der Historie oder der Philosophie - nicht auszudenken, das Glück." Ulrich Raulff in der 'Süddeutschen Zeitung'
"Mit trotzigem Freimut bekennt Schlaffer sich zur 'radikalen Aufklärung'. Einer solchen sind in der deutschen Literatur aber beinahe ausschließlich Geister zweiten Ranges zuzurechnen. Das erklärt vielleicht Schlaffers Frustration als Germanist. Es mag ihm mit der Germanistik gehen wie Prousts Monsieur Swann mit seiner einstigen Liebe Odette, als er erkennt, dass er seine ganze Leidenschaft für eine Frau verschwendet hat, 'die nicht sein Genre war'." Martin Mosebach in der 'Süddeutschen Zeitung'
"Wann ist zum letzten Mal so kenntnisreich und klar, mit derart federnder Eleganz, Literaturgeschichte geschrieben worden? ...Denn dieses Buch ist ein Ereignis - in der Literaturgeschichte und weit darüber hinaus."
Ulrich Raulff, Süddeutsche Zeitung, 26.02.02
"Schlaffer schreibt kenntnisreich, polemisch und provokativ, übrigens auch sehr anschaulich und unterhaltsam: Über diese "kurze Geschichte" können Experten und interessierte Laien lang und produktiv streiten, und das ist mehr, als man von den meisten Konkurrenzunternehmungen sagen kann."
Martin Halter, Tages- Anzeiger Zürich, 8.3.02
Ulrich Raulff, Süddeutsche Zeitung, 26.02.02
"Schlaffer schreibt kenntnisreich, polemisch und provokativ, übrigens auch sehr anschaulich und unterhaltsam: Über diese "kurze Geschichte" können Experten und interessierte Laien lang und produktiv streiten, und das ist mehr, als man von den meisten Konkurrenzunternehmungen sagen kann."
Martin Halter, Tages- Anzeiger Zürich, 8.3.02
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Polemisch schreibt der Autor. Das zumindest will Hanno Helbling den Kritikern des Buches zugestehen. Die These von der "Nationalphilologie", die eine Nationalliteratur erfunden hat, meint der Rezensent, vertritt Schlaffer gleichwohl "beneidenswert brillant". Dabei kommt es Helbling offenbar weniger auf die durchgängige Tragfähigkeit der These an ("Auch Schlaffer führt die Tendenz zur Systematisierung in die Nähe der historischen Erfindung") als vielmehr darauf, dass die von Schlaffer unterstellten "Bruchstellen" im philologisch postulierten Kontinuum der Literaturgeschichte dann und wann immerhin deutlich werden und das Buch dank seiner Kürze und der vom Autor eingestreuten "unzähligen Apercus" "nie langweilig" wird.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH