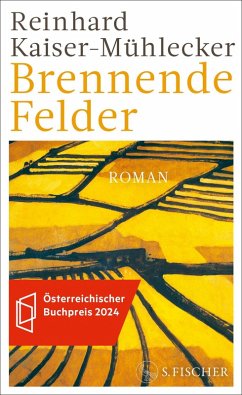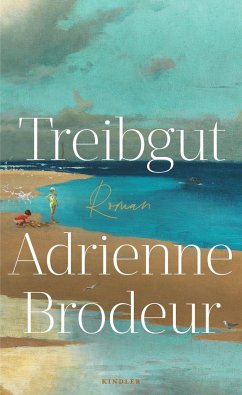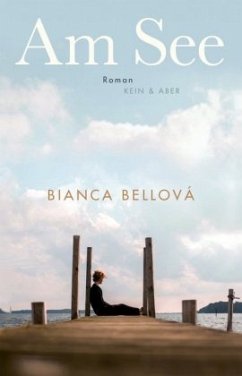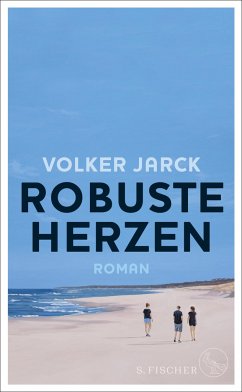Nicht lieferbar
-58%12)

Die Liebe der Väter (Mängelexemplar)
Roman
Die berührende Geschichte eines Vaters, der um seine Tochter kämpftPeter hat eine Tochter, aber das Sorgerecht für sie hat er nicht. Annika war zwei, als er und ihre Mutter sich trennten. Seitdem gerät jede elterliche Absprache zum Machtkampf um die inzwischen dreizehnjährige Annika. Ein Silvesterurlaub auf Sylt wird für Vater und Tochter zur entscheidenden Probe auf ihre Liebe.Die Reise auf die Insel ist für den Verlagsvertreter Peter auch eine Rückkehr in Landschaften der Vergangenheit. Hier hat er die Sommer seiner Kindheit verbracht, als seine Mutter in einer Buchhandlung in Kampen...
Die berührende Geschichte eines Vaters, der um seine Tochter kämpft
Peter hat eine Tochter, aber das Sorgerecht für sie hat er nicht. Annika war zwei, als er und ihre Mutter sich trennten. Seitdem gerät jede elterliche Absprache zum Machtkampf um die inzwischen dreizehnjährige Annika. Ein Silvesterurlaub auf Sylt wird für Vater und Tochter zur entscheidenden Probe auf ihre Liebe.
Die Reise auf die Insel ist für den Verlagsvertreter Peter auch eine Rückkehr in Landschaften der Vergangenheit. Hier hat er die Sommer seiner Kindheit verbracht, als seine Mutter in einer Buchhandlung in Kampen arbeitete. Die Spaziergänge am Strand, die alte Kirche von Keitum, der Leuchtturm rufen Erinnerungen in ihm wach. Zum ersten Mal versucht er, seiner Tochter von sich zu erzählen. Er begegnet Susanne wieder, einer Freundin aus der Schulzeit, mittlerweile verheiratet und Mutter zweier Kinder. Und er muss erleben, dass er auf die Väter der scheinbar heilen Familien, die diese Ferien zusammen verbringen, wie ein Menetekel wirkt.
Es ist die Zeit zwischen den Jahren, die Rauhnächte, in denen Tiere sprechen können und die Tore der Geisterwelt offen stehen. »Die Wilde Jagd« tobt um das Ferienhaus auf der Düne, ein Wintersturm. Und in der Silvesternacht, zusammen mit Freunden im »Sansibar«, steht plötzlich Peters gesamte Existenz auf dem Spiel. Atemlos folgt man seiner Stimme, die erzählt, was ihm geschieht - gegenwärtig, distanzlos, unmittelbar.
Dieser Roman über die Schwierigkeit, heute Vater zu sein, ist Thomas Hettches persönlichstes Buch. Meisterhaft gelingt es ihm, die Atmosphäre des winterlichen Sylt mit einem Familiendrama zu verbinden, in dem es um die eigene Vergangenheit geht, die persönliche Integrität und eine gemeinsame Zukunft.
Peter hat eine Tochter, aber das Sorgerecht für sie hat er nicht. Annika war zwei, als er und ihre Mutter sich trennten. Seitdem gerät jede elterliche Absprache zum Machtkampf um die inzwischen dreizehnjährige Annika. Ein Silvesterurlaub auf Sylt wird für Vater und Tochter zur entscheidenden Probe auf ihre Liebe.
Die Reise auf die Insel ist für den Verlagsvertreter Peter auch eine Rückkehr in Landschaften der Vergangenheit. Hier hat er die Sommer seiner Kindheit verbracht, als seine Mutter in einer Buchhandlung in Kampen arbeitete. Die Spaziergänge am Strand, die alte Kirche von Keitum, der Leuchtturm rufen Erinnerungen in ihm wach. Zum ersten Mal versucht er, seiner Tochter von sich zu erzählen. Er begegnet Susanne wieder, einer Freundin aus der Schulzeit, mittlerweile verheiratet und Mutter zweier Kinder. Und er muss erleben, dass er auf die Väter der scheinbar heilen Familien, die diese Ferien zusammen verbringen, wie ein Menetekel wirkt.
Es ist die Zeit zwischen den Jahren, die Rauhnächte, in denen Tiere sprechen können und die Tore der Geisterwelt offen stehen. »Die Wilde Jagd« tobt um das Ferienhaus auf der Düne, ein Wintersturm. Und in der Silvesternacht, zusammen mit Freunden im »Sansibar«, steht plötzlich Peters gesamte Existenz auf dem Spiel. Atemlos folgt man seiner Stimme, die erzählt, was ihm geschieht - gegenwärtig, distanzlos, unmittelbar.
Dieser Roman über die Schwierigkeit, heute Vater zu sein, ist Thomas Hettches persönlichstes Buch. Meisterhaft gelingt es ihm, die Atmosphäre des winterlichen Sylt mit einem Familiendrama zu verbinden, in dem es um die eigene Vergangenheit geht, die persönliche Integrität und eine gemeinsame Zukunft.