London, in einer nicht wirklich fernen Zukunft: Ein Drogenhändler treibt tot in der Themse, ein Schutzgelderpresser verschwindet spurlos. Ellie Johnson weiß, dass auch sie in Gefahr ist - sie leitet das heißeste Start-up Londons und zugleich das illegalste: Über ihre App bestellt man Drogen in höchster Qualität, und sie werden von Drohnen geliefert. Anonym, sicher, perfekt organisiert.
Die Sache hat nur einen Haken - die gesamte Londoner Unterwelt fühlt sich von ihrem Geschäftsmodell bedroht und will 'Die Lieferantin' tot sehen. Ein Kopfgeld wird auf sie ausgesetzt. Ellie beschließt zu kämpfen - ihre Gegner sind mächtig, und sie lauern an jeder Straßenecke.
Die Sache hat nur einen Haken - die gesamte Londoner Unterwelt fühlt sich von ihrem Geschäftsmodell bedroht und will 'Die Lieferantin' tot sehen. Ein Kopfgeld wird auf sie ausgesetzt. Ellie beschließt zu kämpfen - ihre Gegner sind mächtig, und sie lauern an jeder Straßenecke.
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Rezensent Elmar Krekeler kann nur hoffen, dass die Schraube, an der Zoe Beck in ihrer "Nahzukunftserfahrung" gedreht hat, in der Realität stecken oder noch besser einfach unberührt bleibt, denn die Horrorszenarien, die die Autorin in ihrem Roman "Die Lieferantin" entwirft, sind nur eine einzige Windung von der realen Gegenwart entfernt, warnt der Rezensent. Ausgangspunkt für die Geschichte der Drogenhändlerin Ellie und der Steakhouse-Besitzerin Leigh, die zur Mörderin wird, ist das post-Brexit-London, ein London, indem Gleichberechtigung ein Modewort von gestern ist, in dem alle Hoffnungen und Bemühungen darauf verloren sind und die Enttäuschung über den Verlust mit Drogen gedämpft wird, lesen wir. Becks Visionen sind beängstigend plausibel, "kristallklar", detaillreich und dabei nie belehrend, oberflächlich oder reißerisch, lobt der begeisterte Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Eine Begegnung mit Zoë Beck, die keine Regional- und keine Frauenkrimis schreiben wollte. Zum Glück bis heute nicht
Die Drohne war früh aufgestiegen, sie schwebte schon über dem Exposé, gerade mal so groß wie ein Spatz, Zoë Beck hatte es nur noch nicht bemerkt. Sie wollte in ihrem neuen Roman von Drogen erzählen und von organisierter Kriminalität, von einer jungen Frau in London, die Drogen verkauft. Dazu hatte sie recherchiert. Ein Bekannter hatte ungefähr zu der Zeit eine Dokumentation über Drohnen fertiggestellt, sie fand das Thema aufregend, und auf einmal, sagt Zoë Beck, "machte es dann Klick". Es kam zusammen, was sehr gut zusammenpasst, wenn man den Kriminalroman "Die Lieferantin" liest.
Die junge Ellie, so heißt die Titelfigur, hat ein Start-up-Unternehmen, das Hightech-Drohnen entwickelt, und ohne Wissen ihres Auftraggebers hat sie ein gutes Dutzend davon an Leute verteilt, die damit nach Bestellung im Darknet Drogen in Greater London zustellen, beste Qualität, sicher, geräuschlos, gelegentlich wegen heftiger Witterungsbedingungen mal nicht einsatzfähig. Und mit einer politischen Agenda: Weil die britische Regierung nach dem Brexit den "Druxit" plant, weil sie an die Schimäre eines drogenfreien Großbritanniens glaubt, dealt die Lieferantin für die Freiheit, "dass erwachsenen Menschen zugestanden wurde, Entscheidungen für sich zu treffen, nachdem sie sich informiert hatten und wussten, welche Risiken sie eingingen".
Leider gebe es derart leistungsfähige Drohnen noch nicht, sie habe da ein wenig hinzuerfinden müssen, sagt Zoë Beck mit einem Lächeln, während wir beim Mittagessen in Berlin-Zehlendorf sitzen, weit entfernt von Mitte. Hier ist Berlin noch provinziell und dörflich, wie es früher zu West-Berlin-Zeiten war, hier wohnt der Bundespräsident gleich um die Ecke, weshalb man sich bei der Parkplatzsuche misstrauischen Polizistenblicken aussetzt. Die 42-Jährige wohnt hier, in dieser Halbdistanz zur Stadt, Randlagen hat sie schon, als sie in Hamburg und in München lebte, geschätzt.
"Die Lieferantin" ist bereits ihr achter Kriminalroman, wenn man die fünf nicht mitzählt, die sie unter ihrem Geburtsnamen Henrike Heiland veröffentlicht hat. Als Zoë Beck, wie sie sich nach einem Einschnitt in ihrem Leben nannte, wechselte sie auch Schauplätze und Schreibstil, wenngleich sie sagt: "Ich versuche ja auch, in jedem Buch eine Stimme zu finden." Dass die Beck-Bücher in England und Schottland spielen, liegt ganz einfach daran, dass sie Anglistik studiert und in England gelebt hat, dass ihr diese Welt vertraut ist. Der Terrainwechsel hat allerdings auch damit zu tun, dass die Vorgaben der Verlage für Krimis, die in Deutschland spielen, ihr damals, vor knapp zehn Jahren, viel zu eng waren. Gewünscht waren Regionalkrimis, und bloß nicht zu düster. Henrike Heiland musste sich anhören, ihre Themen seien "zu schwer", man könne die Bücher schließlich nur in der Region verkaufen.
Und Zoë Beck ärgert sich noch heute darüber, wie die Einkäufer der großen Buchhandelsketten beinahe diktierten, was geschrieben wurde. Was die Leute angeblich lesen wollten, das wurde an die Agenten weitergegeben, die dann zu ihren Autoren sagten: "Willst du das nicht auch mal probieren?" Sie wollte nicht. Erst recht wollte sie nicht dem entsprechen, was das Label "Frauenkrimi" gemeinhin so vorsieht. Und weil Zoë Beck als Person wie als Erzählerin einen ausgeprägten Sinn für Ironie hat, spricht sie mit höflicher Distanz von "Strukturvorgaben" der Verlage, die auf vermeintlich unanfechtbaren Erkenntnissen darüber beruhen, welche Bücher Männer schreiben und welche sie lesen - und welche nicht, Bücher von Frauen nämlich.
Dass sie nach England auswich, wurde natürlich auch nicht bejubelt, aber für Zoë Beck war es eine Befreiung vom Zwang zum possierlichen Lokalkolorit. Sie musste sich auch weiterhin behaupten und streiten für ihre Projekte, auch dort, wo es um den Buchtitel ging oder um die Gestaltung des Covers. "Es war immer ein Kampf", sagt sie, bei dem sie mal gewonnen und mal verloren habe.
Mit dem Umschlag der "Lieferantin" ist sie zufrieden, das Hochglanz-London-Bild mit der kleinen Drohne aus dem Photoshop ist ihr (und uns) erspart geblieben. Auch ohne Kampf. Es hätte tatsächlich nicht gepasst zu diesem Ensembleroman, der mit dem charmanten kleinen Hinweis beginnt: "London, vielleicht bald". Als sie zu schreiben begann, war der Brexit absehbar, wenngleich sie jeden Tag gehofft habe, er möge sich noch mal abwenden lassen. Im Roman ist er Realität, und die Folgen sind so hässlich, wie man das erwarten darf.
Kapitel für Kapitel bis hin zur Eskalation entfaltet sich das komplizierte Geflecht der handelnden Personen. Der Wirt Leigh, der den zu gierigen Schutzgelderpresser Gonzo umgebracht und die Leiche unterm neu betonierten Fußboden im Lagerraum deponiert hat, ist ein Katalysator: Das Verschwinden Gonzos alarmiert den Boyce-Clan, für den er tätig war, die Drogengroßhändler sehen sich unter Druck, ihr Image leidet, weil sie nicht kundengerecht arbeiten und Marktanteile an "Legalisierungs-Gutmenschen" wie Ellie verlieren, weil die den besseren Service und die modernste Zustellmethode hat. Dass die Wunderdrohnen bei jedem Abwurf Fotos der Kunden machen, ist so etwas wie eine Rückversicherung. Ellie wird sie ziemlich schnell brauchen, und es hilft, dass sich in ihrer Kundendatei natürlich auch hochrangige Gestalten aus Polizei und Verwaltung mit Bild finden.
Während im Untergrund ein kleiner Drogenkrieg beginnt, geht es auf den Straßen Londons rauh zu. Die Anti-Druxit-Kampagne prallt auf die nationalistische Bewegung der "Rotweißblauen", benannt nach den Farben des Union Jacks, Autos brennen, das Gesundheitssystem schwächelt. Dann bricht Ellie ihr Hauptlieferant weg, und die Old Economy des Drogenhandels setzt ein Kopfgeld auf sie aus.
Zoë Beck hat die Fäden dabei fest in der Hand. Die Querverbindungen, die sich zwischen den Personen ergeben, sind schlüssig, und die Kausalkette, die aus den verschiedenen Ereignissen entsteht, wirkt nie forciert. Nur ganz selten steht da mal ein Satz, der ein wenig zu erläuternd oder didaktisch wirkt. Dass Zoë Becks Sympathie den Befürwortern der Legalisierung gehört, macht das Buch nicht zum Thesenroman mit einer politischen Agenda. Die Beschäftigung mit Drogen, sagt sie, habe bei ihr eine lange Geschichte. "Ich habe selbst nie - zum Glück - den Drang gehabt oder Suchterfahrungen gemacht." Aber sie kenne viele Menschen aus ihrem Umfeld, die in trostlose Drogenkarrieren gestolpert seien, junge Menschen aus scheinbar intakten, normalen Familien.
"Verbote sind keine Lösung", sagt Zoë Beck, es sei doch seit langem bekannt, dass Prohibition den Griff zu härteren Drogen nahezu automatisch nach sich ziehe. "Ich weiß ja auch nicht, wie man mit Dingen wie Crystal Meth umgehen soll", sagt sie mit einem ratlosen Achselzucken, aber so etwas wie der fiktive "Druxit" im Roman stürze die Abhängigen nur immer tiefer hinein in die Ausweglosigkeit. Und nicht nur als Leserin der Drogenkrimis von Don Winslow sind ihr die politischen und gesellschaftlichen Implikationen sehr bewusst.
Romane sollen ja auch keine politischen Plädoyers ersetzen, und "Die Lieferantin" tut auch nicht so, als kenne sie ein Rezept. Zoë Beck weiß dafür, wie man einen Spannungsbogen entwirft, und es hat ihr sicher nicht geschadet, dass sie, bevor sie Schriftstellerin wurde, als Producerin im längst untergegangenen Medienimperium von Leo Kirch gearbeitet hat. Sie betreute internationale Koproduktionen, sie verdiente gut, die Arbeit machte ihr Spaß. Sie habe sich damals allenfalls vorstellen können, mal ein Drehbuch zu schreiben, sagt sie. An Prosa habe sie nie gedacht.
Als die Kirch-Pleite kam, als die Blase der New Economy platzte, musste sie auf einmal ganz neu anfangen. Sie betreute Kinderprogramme, schrieb hier und da, "und dann fragte eine ehemalige Kollegin, die nach der Kirch-Pleite zu einer Literaturagentur gegangen war: ,Möchtest du nicht Romane schreiben? Ich glaube, du kannst das.' Ich sagte: ,Nein, kann ich nicht', und daraus wurde dann ein Vertrag über drei Bücher." Sie machte sich selbständig, und dann erschloss sich noch ein weiterer Horizont. Sie hatte für den Disney Channel gearbeitet, und da fragte man sie eines Tages, ob sie nicht die Redaktion für Synchronproduktionen übernehmen wolle, da es keine Eigenproduktionen mehr gab. Sie habe kurz nachgedacht und dann entschlossen gesagt: "Krieg' ich hin!"
Wenn sie von dieser Arbeit erzählt, die sie bis heute regelmäßig macht, ist sie mindestens so leidenschaftlich wie im Gespräch über Bücher. Sie hat, unter anderem, die deutsche Fassung einer Staffel von "Orange Is the New Black" geschrieben und Regie geführt bei der vierten Staffel von "The Walking Dead". Es mache ihr riesigen Spaß, sagt sie, den richtigen Ton zu treffen, die Vorlage in sprechbares, lebendiges Deutsch zu verwandeln und mit Schauspielern zu arbeiten, auch wenn das gelegentlich dazu führe, dass man jemanden entlassen müsse, der oder die der Rolle nicht gewachsen sei. Und sie kann sich herrlich lustig machen über das mangelnde Sprachgefühl mancher Übersetzer. Bei einem Cartoon mit einem unübersehbaren Staubsauger im Bild, erzählt sie, habe der Dialogbuchautor daraus gemacht: "Wir haben ein großes Vakuum hier."
Zoë Beck muss jetzt noch lachen, wenn sie daran denkt. Nicht weil sie sich für die größte aller Übersetzerinnen hält, sondern weil sie aus der langjährigen Vertrautheit mit der englischsprachigen Literatur weiß, dass Respekt und eine gewisse Demut dazugehören und acht Jahre Schulenglisch keine hinreichende Qualifikation fürs Übersetzen sind, weder für eine amerikanische Serie noch für Henry James.
So sind wir dann am Ende doch wieder bei den Büchern gelandet, bei den Kriminalromanen, die sie "nur noch sehr ausgewählt" liest, "da überrascht einen wenig", oder bei Vladimir Nabokovs Roman "Fahles Feuer", den sie sehr bewundert, bei Autoren, die sie schätzt, ohne dass sie deshalb jetzt von so ominösen Faktoren wie Prägung oder Einfluss reden wollte. Und so weit ihre Leseinteressen auch gespannt sind - eine Textsorte meidet sie derzeit, da "Die Lieferantin" gerade mal auf dem Markt ist, lieber: Rezensionen ihres eigenen Buches.
PETER KÖRTE
Zoë Beck: "Die Lieferantin". Thriller. Suhrkamp, 326 Seiten, 14,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»So komplex die Handlung, so rasant liest sich dieser Roman weg, den als 'Thriller' zu bezeichnen - rein literarisch gesehen - eigentlich eine Untertreibung ist. ... Und nicht nur in handwerklicher Hinsicht ragt dieser Kriminalroman weit heraus aus der großen Genre-Masse.« Katharina Granzin taz. die tageszeitung 20171118

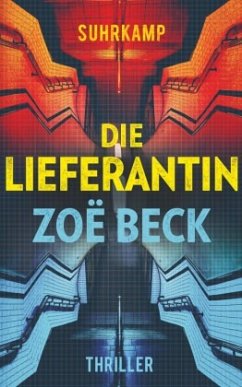


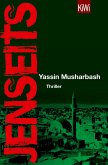

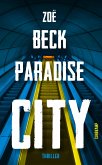


anettegoettlicher_web.jpg)