Nicht lieferbar
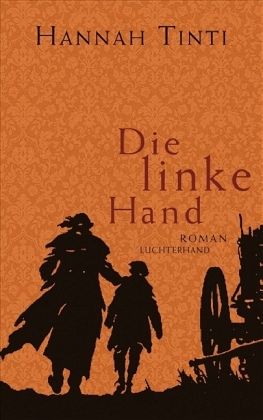
Die linke Hand
Roman
Übersetzung: Rumler, Irene
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
New England im 19. Jahrhundert: Der Waisenjunge Ren ist überglücklich, als plötzlich ein junger Mann in seinem Heim auftaucht, der behauptet, sein Bruder zu sein. Der Fremde nimmt ihn mit und entführt ihn in eine abenteuerliche Welt von Gaunern, Trickdieben und Grabräubern.Ren, ein zwölfjähriger Junge, ist in St. Anthony s aufgewachsen, einem kirchlichen Waisenhaus für Arme in New England, wo er als Säugling »abgegeben« wurde. Seit seiner Kindheit fehlt ihm die linke Hand. Er weiß nicht, was mit ihm passiert ist, auch nicht, woher er kommt oder wer seine Eltern sind. Als plötzlich...
New England im 19. Jahrhundert: Der Waisenjunge Ren ist überglücklich, als plötzlich ein junger Mann in seinem Heim auftaucht, der behauptet, sein Bruder zu sein. Der Fremde nimmt ihn mit und entführt ihn in eine abenteuerliche Welt von Gaunern, Trickdieben und Grabräubern.
Ren, ein zwölfjähriger Junge, ist in St. Anthony s aufgewachsen, einem kirchlichen Waisenhaus für Arme in New England, wo er als Säugling »abgegeben« wurde. Seit seiner Kindheit fehlt ihm die linke Hand. Er weiß nicht, was mit ihm passiert ist, auch nicht, woher er kommt oder wer seine Eltern sind. Als plötzlich Benjamin Nab auftaucht, ein junger Mann, der behauptet, sein Bruder zu sein, tut sich für Ren eine neue Welt auf. Benjamin führt Ren in seine Bande von Gaunern und Trickdieben ein, die auch als »Körperjäger« arbeiten: Sie stehlen nachts frisch beerdigte Leichen vom Friedhof und verkaufen sie zu medizinischen Forschungszwecken an Krankenhäuser. Trotz seines schlechten Gewissens findet Ren Gefallen an diesem freien Vagabundenleben, er lernt neue Freunde kennen, darunter einen Mörder und einen Zwerg, zieht mit seinen Gefährten über Farmland, durch Küstenstädte und erste Fabriksiedlungen, stets auf der Flucht. Doch ist Benjamin wirklich der, als der er sich ausgibt? Oder ist er einfach nur ein begnadeter Schwindler? Allmählich ahnt Ren, dass sein neuer Freund mehr über seine eigene Vergangenheit weiß, als er zugibt
Ren, ein zwölfjähriger Junge, ist in St. Anthony s aufgewachsen, einem kirchlichen Waisenhaus für Arme in New England, wo er als Säugling »abgegeben« wurde. Seit seiner Kindheit fehlt ihm die linke Hand. Er weiß nicht, was mit ihm passiert ist, auch nicht, woher er kommt oder wer seine Eltern sind. Als plötzlich Benjamin Nab auftaucht, ein junger Mann, der behauptet, sein Bruder zu sein, tut sich für Ren eine neue Welt auf. Benjamin führt Ren in seine Bande von Gaunern und Trickdieben ein, die auch als »Körperjäger« arbeiten: Sie stehlen nachts frisch beerdigte Leichen vom Friedhof und verkaufen sie zu medizinischen Forschungszwecken an Krankenhäuser. Trotz seines schlechten Gewissens findet Ren Gefallen an diesem freien Vagabundenleben, er lernt neue Freunde kennen, darunter einen Mörder und einen Zwerg, zieht mit seinen Gefährten über Farmland, durch Küstenstädte und erste Fabriksiedlungen, stets auf der Flucht. Doch ist Benjamin wirklich der, als der er sich ausgibt? Oder ist er einfach nur ein begnadeter Schwindler? Allmählich ahnt Ren, dass sein neuer Freund mehr über seine eigene Vergangenheit weiß, als er zugibt



