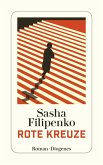Sofia liebt Listen - Listen von Schokoladensorten oder peinlichen Hundenamen. Diese Sammlungen bringen Ordnung in ihr Leben: An das Dasein als Mutter hat Sofia sich noch nicht gewöhnt, ihre Großmutter dämmert dement vor sich hin, und auch sonst läuft wenig rund. Eines Tages macht Sofia in der großmütterlichen Wohnung eine Entdeckung: eine andere Listensammlung, in kyrillischer Schrift - die Familie hat in den Siebzigern die Sowjetunion verlassen. Über diesen Fund stößt Sofia auf einen geheimnisvollen Onkel: ein lustiger, schräger Querkopf, der sich aber auch im Untergrund betätigt hat. Sofie spürt Onkel Grischas dunkler Geschichte nach und entdeckt, was die Vergangenheit für sie bedeutet.
Ein in jeder Hinsicht umwerfender Roman NZZ am Sonntag

Lena Gorelik macht mit einer Familie Ernst
Die Neuauflage des Lexikons der deutsch-jüdischen Literatur verzeichnet einen Artikel zu "Gorelik, Lena, geb. 1. 2. 1981 in Leningrad (Sankt Petersburg)" und lässt den Leser wissen, das Schreiben dieser jungen Autorin kreise um die Frage der Normalität jüdischen Lebens in Deutschland nach der Schoa. Und tatsächlich verarbeitet Lena Gorelik seit ihrem erfolgreichen Debütroman "Meine weißen Nächte" die Erfahrung, als Kind russischer Einwanderer nach Deutschland gekommen zu sein und sich hier plötzlich als Jüdin zu fühlen. In einem Briefroman an ihren Sohn spielte sie mit äußeren Zuschreibungen, mit Klischees und Projektionen und seufzte über die Vielschichtigkeit jeglicher Identität.
Mit der macht sie nun Ernst. Denn ihr neuer Roman verzichtet auf das bisher zentrale Thema, gerade jetzt, wo sich das Bild der Autorin zu verfestigen begann. "Die Listensammlerin" ist ein komischer und ernster Familienroman, dessen Figuren-Ensemble sich auf zwei narrativen Ebenen bewegt. Die Ich-Erzählerin lebt in der Münchner Gegenwart, eine temperamentvolle junge Frau mit einer großen Sorge: Ihre kleine Tochter hat ein krankes Herz und steht vor einer lebenswichtigen Operation. Die Angst um das Kind ist ein Teil des trotz allem mit Leichtigkeit geschilderten Alltags, zu dem auch die Mutter und die Großmutter der Ich-Erzählerin gehören. Beide Frauen sind vor Jahren aus der Sowjetunion nach Deutschland immigriert, und der oft peinlich berührte Tochterblick auf ihre Eigenarten (Spucken beim Bügeln) sorgt für einen humorvollen Ton und einige transkulturelle Spiegeleffekte. Die Einwanderungsthematik führt Lena Gorelik fort und vergewissert sich dabei, wie viele ihrer Generationsgenossinnen, der eigenen Herkunft.
Der zweite, parallel geführte Erzählstrang spielt in der poststalinistischen Sowjetunion. Der Leser folgt hier der Perspektive Grischas, eines anarchisch wilden Jungen, dessen Verhalten zugleich komisch und erschreckend ist. Er ist der Onkel der Ich-Erzählerin, von dessen Existenz und Schicksal diese erst nach und nach erfährt. Die Protagonisten der beiden Romanebenen verbindet eine Passion: das Führen und Sammeln von Listen, mit deren Hilfe das chaotisch andrängende Leben geordnet und gebändigt werden soll. Die junge Frau der Gegenwart erstellt Listen schöner Menschen, von Momenten, die sie nie erleben wollte, Listen mit Tomatengerichten. Der junge Sowjet führt Listen mit Männerhänden, Listen zu lesender Literatur und eine Liste mit Wünschen für die eigene Mutter, der er Arbeit und Leid ersparen möchte. Die Mutter leidet, weil ihr Sohn als unbekümmerter und querulatorischer Individualist ohne jedes Autoritätsempfinden heranwächst und sich bereits als Jugendlicher einer antisowjetischen Gruppe anschließt.
Im Gewand des plaudernden Familienromans liefert Lena Gorelik das Psychogramm eines Dissidenten in seiner ganzen sozialen Ambivalenz. Seine Selbst- und Freiheitsliebe, seine Leichtfertigkeit und sein Mut machen ihn zum Außenseiter und disponieren ihn zur Opposition. Zugleich gefährden seine Charaktereigenschaften und Aktionen die ihm nächsten Menschen und bestimmen ihr Schicksal. Deren Lebensläufe verbinden die russische Vergangenheit und die erzählte Gegenwart. Die Autorin führt aber auch Motive beider Erzählebenen parallel: In Moskau fotografiert der empörte Grischa die menschenunwürdigen Zustände in einem Heim, in dem Systemgegner, Kriegsversehrte und Verrückte vegetieren. In München leidet die Ich-Erzählerin bei jedem ihrer Besuche in einem Altenheim mit den Alzheimerkranken.
Die Darstellung schafft eine eindeutige Differenz zwischen den Systemen. Sie spricht für die selbstverständliche Nähe der Autorin zum Land, in dem sie lebt. Hinter den gewichtigen, den komischen und den feinen Unterschieden, die in diesem Roman geschildert werden, steht allerdings das allen Menschen Gemeinsame. Es findet in der mütterlichen Angst seinen Ausdruck: in der Sorge um den eigensinnigen Jungen, in der Sorge um das kranke Kind. Sie überdauert die Generationen und geht über Grenzen.
SANDRA KERSCHBAUMER.
Lena Gorelik: "Die Listensammlerin". Roman.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2013. 350 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Hingerissen zeigt sich Rainer Moritz von Lena Goreliks Roman "Die Listensammlerin" und weist gleich darauf hin, dass man diesen nicht wegen seiner Titelähnlichkeit mit seichten Historienromanen wie "Die Gewürzhändlerin" oder "Die Mondspielerin" verwechseln darf. Die Geschichte von Sofia, einer Schriftstellerin in München, die immer wieder in Krisen gerät und sich sehr um ihr herzkrankes Kind sorgt, und ihrem in der Sowjetunion aufgewachsenen Onkel Grischa erzählt für ihn einfühlsam von unterschwelligen familiären Brüchen und davon, wie sehr die Lebensgeschichte der Vorfahren die eigene prägt. Dabei gelingt der Autorin zur Freude des Rezensenten eine gute Balance aus Ernsthaftigkeit und Humor. Besonders lobt er die Klarheit von Goreliks Stil und ihren "feinen, gewitzten Tonfall". Für Moritz ist steht fest: "Mit dem Mond sollen andere spielen."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Überleben mit Listen
Lena Gorelik macht mit einer Familie Ernst
Die Neuauflage des Lexikons der deutsch-jüdischen Literatur verzeichnet einen Artikel zu "Gorelik, Lena, geb. 1. 2. 1981 in Leningrad (Sankt Petersburg)" und lässt den Leser wissen, das Schreiben dieser jungen Autorin kreise um die Frage der Normalität jüdischen Lebens in Deutschland nach der Schoa. Und tatsächlich verarbeitet Lena Gorelik seit ihrem erfolgreichen Debütroman "Meine weißen Nächte" die Erfahrung, als Kind russischer Einwanderer nach Deutschland gekommen zu sein und sich hier plötzlich als Jüdin zu fühlen. In einem Briefroman an ihren Sohn spielte sie mit äußeren Zuschreibungen, mit Klischees und Projektionen und seufzte über die Vielschichtigkeit jeglicher Identität.
Mit der macht sie nun Ernst. Denn ihr neuer Roman verzichtet auf das bisher zentrale Thema, gerade jetzt, wo sich das Bild der Autorin zu verfestigen begann. "Die Listensammlerin" ist ein komischer und ernster Familienroman, dessen Figuren-Ensemble sich auf zwei narrativen Ebenen bewegt. Die Ich-Erzählerin lebt in der Münchner Gegenwart, eine temperamentvolle junge Frau mit einer großen Sorge: Ihre kleine Tochter hat ein krankes Herz und steht vor einer lebenswichtigen Operation. Die Angst um das Kind ist ein Teil des trotz allem mit Leichtigkeit geschilderten Alltags, zu dem auch die Mutter und die Großmutter der Ich-Erzählerin gehören. Beide Frauen sind vor Jahren aus der Sowjetunion nach Deutschland immigriert, und der oft peinlich berührte Tochterblick auf ihre Eigenarten (Spucken beim Bügeln) sorgt für einen humorvollen Ton und einige transkulturelle Spiegeleffekte. Die Einwanderungsthematik führt Lena Gorelik fort und vergewissert sich dabei, wie viele ihrer Generationsgenossinnen, der eigenen Herkunft.
Der zweite, parallel geführte Erzählstrang spielt in der poststalinistischen Sowjetunion. Der Leser folgt hier der Perspektive Grischas, eines anarchisch wilden Jungen, dessen Verhalten zugleich komisch und erschreckend ist. Er ist der Onkel der Ich-Erzählerin, von dessen Existenz und Schicksal diese erst nach und nach erfährt. Die Protagonisten der beiden Romanebenen verbindet eine Passion: das Führen und Sammeln von Listen, mit deren Hilfe das chaotisch andrängende Leben geordnet und gebändigt werden soll. Die junge Frau der Gegenwart erstellt Listen schöner Menschen, von Momenten, die sie nie erleben wollte, Listen mit Tomatengerichten. Der junge Sowjet führt Listen mit Männerhänden, Listen zu lesender Literatur und eine Liste mit Wünschen für die eigene Mutter, der er Arbeit und Leid ersparen möchte. Die Mutter leidet, weil ihr Sohn als unbekümmerter und querulatorischer Individualist ohne jedes Autoritätsempfinden heranwächst und sich bereits als Jugendlicher einer antisowjetischen Gruppe anschließt.
Im Gewand des plaudernden Familienromans liefert Lena Gorelik das Psychogramm eines Dissidenten in seiner ganzen sozialen Ambivalenz. Seine Selbst- und Freiheitsliebe, seine Leichtfertigkeit und sein Mut machen ihn zum Außenseiter und disponieren ihn zur Opposition. Zugleich gefährden seine Charaktereigenschaften und Aktionen die ihm nächsten Menschen und bestimmen ihr Schicksal. Deren Lebensläufe verbinden die russische Vergangenheit und die erzählte Gegenwart. Die Autorin führt aber auch Motive beider Erzählebenen parallel: In Moskau fotografiert der empörte Grischa die menschenunwürdigen Zustände in einem Heim, in dem Systemgegner, Kriegsversehrte und Verrückte vegetieren. In München leidet die Ich-Erzählerin bei jedem ihrer Besuche in einem Altenheim mit den Alzheimerkranken.
Die Darstellung schafft eine eindeutige Differenz zwischen den Systemen. Sie spricht für die selbstverständliche Nähe der Autorin zum Land, in dem sie lebt. Hinter den gewichtigen, den komischen und den feinen Unterschieden, die in diesem Roman geschildert werden, steht allerdings das allen Menschen Gemeinsame. Es findet in der mütterlichen Angst seinen Ausdruck: in der Sorge um den eigensinnigen Jungen, in der Sorge um das kranke Kind. Sie überdauert die Generationen und geht über Grenzen.
SANDRA KERSCHBAUMER.
Lena Gorelik: "Die Listensammlerin". Roman.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2013. 350 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Lena Gorelik macht mit einer Familie Ernst
Die Neuauflage des Lexikons der deutsch-jüdischen Literatur verzeichnet einen Artikel zu "Gorelik, Lena, geb. 1. 2. 1981 in Leningrad (Sankt Petersburg)" und lässt den Leser wissen, das Schreiben dieser jungen Autorin kreise um die Frage der Normalität jüdischen Lebens in Deutschland nach der Schoa. Und tatsächlich verarbeitet Lena Gorelik seit ihrem erfolgreichen Debütroman "Meine weißen Nächte" die Erfahrung, als Kind russischer Einwanderer nach Deutschland gekommen zu sein und sich hier plötzlich als Jüdin zu fühlen. In einem Briefroman an ihren Sohn spielte sie mit äußeren Zuschreibungen, mit Klischees und Projektionen und seufzte über die Vielschichtigkeit jeglicher Identität.
Mit der macht sie nun Ernst. Denn ihr neuer Roman verzichtet auf das bisher zentrale Thema, gerade jetzt, wo sich das Bild der Autorin zu verfestigen begann. "Die Listensammlerin" ist ein komischer und ernster Familienroman, dessen Figuren-Ensemble sich auf zwei narrativen Ebenen bewegt. Die Ich-Erzählerin lebt in der Münchner Gegenwart, eine temperamentvolle junge Frau mit einer großen Sorge: Ihre kleine Tochter hat ein krankes Herz und steht vor einer lebenswichtigen Operation. Die Angst um das Kind ist ein Teil des trotz allem mit Leichtigkeit geschilderten Alltags, zu dem auch die Mutter und die Großmutter der Ich-Erzählerin gehören. Beide Frauen sind vor Jahren aus der Sowjetunion nach Deutschland immigriert, und der oft peinlich berührte Tochterblick auf ihre Eigenarten (Spucken beim Bügeln) sorgt für einen humorvollen Ton und einige transkulturelle Spiegeleffekte. Die Einwanderungsthematik führt Lena Gorelik fort und vergewissert sich dabei, wie viele ihrer Generationsgenossinnen, der eigenen Herkunft.
Der zweite, parallel geführte Erzählstrang spielt in der poststalinistischen Sowjetunion. Der Leser folgt hier der Perspektive Grischas, eines anarchisch wilden Jungen, dessen Verhalten zugleich komisch und erschreckend ist. Er ist der Onkel der Ich-Erzählerin, von dessen Existenz und Schicksal diese erst nach und nach erfährt. Die Protagonisten der beiden Romanebenen verbindet eine Passion: das Führen und Sammeln von Listen, mit deren Hilfe das chaotisch andrängende Leben geordnet und gebändigt werden soll. Die junge Frau der Gegenwart erstellt Listen schöner Menschen, von Momenten, die sie nie erleben wollte, Listen mit Tomatengerichten. Der junge Sowjet führt Listen mit Männerhänden, Listen zu lesender Literatur und eine Liste mit Wünschen für die eigene Mutter, der er Arbeit und Leid ersparen möchte. Die Mutter leidet, weil ihr Sohn als unbekümmerter und querulatorischer Individualist ohne jedes Autoritätsempfinden heranwächst und sich bereits als Jugendlicher einer antisowjetischen Gruppe anschließt.
Im Gewand des plaudernden Familienromans liefert Lena Gorelik das Psychogramm eines Dissidenten in seiner ganzen sozialen Ambivalenz. Seine Selbst- und Freiheitsliebe, seine Leichtfertigkeit und sein Mut machen ihn zum Außenseiter und disponieren ihn zur Opposition. Zugleich gefährden seine Charaktereigenschaften und Aktionen die ihm nächsten Menschen und bestimmen ihr Schicksal. Deren Lebensläufe verbinden die russische Vergangenheit und die erzählte Gegenwart. Die Autorin führt aber auch Motive beider Erzählebenen parallel: In Moskau fotografiert der empörte Grischa die menschenunwürdigen Zustände in einem Heim, in dem Systemgegner, Kriegsversehrte und Verrückte vegetieren. In München leidet die Ich-Erzählerin bei jedem ihrer Besuche in einem Altenheim mit den Alzheimerkranken.
Die Darstellung schafft eine eindeutige Differenz zwischen den Systemen. Sie spricht für die selbstverständliche Nähe der Autorin zum Land, in dem sie lebt. Hinter den gewichtigen, den komischen und den feinen Unterschieden, die in diesem Roman geschildert werden, steht allerdings das allen Menschen Gemeinsame. Es findet in der mütterlichen Angst seinen Ausdruck: in der Sorge um den eigensinnigen Jungen, in der Sorge um das kranke Kind. Sie überdauert die Generationen und geht über Grenzen.
SANDRA KERSCHBAUMER.
Lena Gorelik: "Die Listensammlerin". Roman.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2013. 350 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main