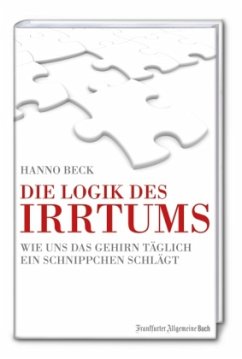Warum führt uns der Zufall immer wieder an der Nase herum und was hat das mit der Steuerfahndung zu tun? Wieso können wir uns nicht von unseren Vorurteilen befreien, fallen auf Hellseher und dubiose Prognosen herein? Warum kann Nichtwissen vorteilhaft sein? Wer mit beiden Beinen im Leben steht, hat sich von der Idee des Menschen als Rationalitätsmaschine schon längst verabschiedet. Doch warum machen wir so viele Fehler und wieso lernen wir so wenig von all den Ratgebern und Entscheidungshilfen? Ökonomen und Psychologen kommen dem vermeintlichen Homo sapiens immer mehr auf die Schliche: Sie suchen nach den verborgenen Gesetzen des Irrens und Scheiterns, die in unserem Kopf walten. Ihre - mittlerweile nobelpreisgeadelten - Experimente zeigen erstaunliche Schwächen des menschlichen Geistes: Wir haben Angst vor Verlusten, wir sind unserem Besitz verfallen, lassen uns bei unserer Entscheidungsfindung zu sehr von unwichtigen Fakten und Eindrücken beeinflussen, und unsere geistige Kontenführung bringt uns um unsere Ausgabendisziplin. Ob beim Einkauf, bei der Arbeit, beim Investieren, bei Verhandlungen mit Verkäufern, Kunden oder Partnern: Der eingebaute Fehlergenerator in unserem Kopf kostet uns Geld, Zeit und Nerven - jeden Tag aufs Neue. Wer erkennt, wann und wie unser Gehirn uns Sand ins Getriebe der Vernunft streut, tut den ersten Schritt, den Gesetzen des Scheiterns ein Schnippchen zu schlagen.

Bisher war Behavioral Economics nur etwas für Eingeweihte. Jetzt wird die neue Theorie populär.
VON LISA NIENHAUS
Stellen Sie sich vor, Sie wären auf einer Feier und zur Unterhaltung würde folgendes Spiel angekündigt: Jeder Gast muss eine Zahl zwischen null und hundert auf einen Zettel schreiben. Die Zettel werden eingesammelt, und der Durchschnitt der Zahlen wird ermittelt. Wer mit seiner Zahl am nächsten an zwei Dritteln des Durchschnitts liegt, hat gewonnen. Welche Zahl würden Sie aufschreiben?
Kurz nachgerechnet: Würde jeder Gast einfach irgendeine Zahl angeben, läge der Durchschnitt bei 50, zwei Drittel davon sind 33. Es wäre also sinnvoll, die 33 auf den Zettel zu schreiben. Doch so weit können auch die anderen denken. Schreiben alle 33 auf den Zettel, dann ist der Durchschnitt aller Zahlen 33, zwei Drittel davon sind 22. Also sollte man die 22 wählen. Und so weiter. Wenn man annimmt, dass alle Gäste vollkommen rational handeln und all diese Schritte zu Ende denken, müsste man die Zahl Null angeben.
Das tut aber kaum jemand. Und die, die es tun, handeln nicht besonders klug. Denn die wenigsten Menschen können einen solchen Gedankengang zu Ende denken. In den wenigsten Fällen wird also Null die Zahl sein, die gewinnt. Der Mensch ist nicht ganz rational - zumindest weniger, als den Ökonomen lieb ist.
Über Jahre haben Volkswirte die Annahme des Homo oeconomicus, des rationalen Gewinnmaximierers, für plausibel gehalten - oder zumindest für eine gute Annäherung an die Wirklichkeit. Spiele wie das beschriebene zeigen: Sie haben es sich zu leicht gemacht. Es gibt nämlich nicht nur einige wenige Situationen, in denen der Mensch das Schema F der vollkommenen Rationalität verlässt und völlig anders handelt. Es gibt deren Hunderte, Tausende.
Zum Beispiel bereiten uns Verluste weit größere Schmerzen, als angebracht wäre, um rationale Entscheidungen zu treffen. In der Folge trennen wir uns oft zu spät von schlechten Wertpapieren. Derweil lieben wir unverhältnismäßig, was wir besitzen. Eine Tasse, die uns gehört, ist uns auf einmal weit teurer, als wir bereit wären zu zahlen, um eine solche Tasse zu kaufen. Haben wir eine Tafel Schokolade erhalten und können sie danach gegen einen Stift tauschen, so wollen viel weniger von uns den Stift, als wenn wir von Anfang an zwischen Schokolade und Stift hätte wählen können.
Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass der Mensch chaotisch und nicht vorhersagbar handelt. Vielmehr muss sein Verhalten anders erklärt werden. Es ist die junge Wissenschaft der Verhaltensökonomik (Behavioral Economics), die hier nach Lösungen sucht. Sie hinterfragt althergebrachte Wahrheiten und beweist mit Hilfe von Experimenten, wo der Mensch von der Theorie abweicht. Dann versucht sie, die Abweichungen zu erklären.
Noch sind ihre Erkenntnisse sehr frisch und weitgehend ungeordnet. Doch so viel ist schon klar: Die komplizierten Modelle, die sich die Volkswirte alten Schlags von der Wirtschaft und den Menschen gemacht haben, müssen überdacht werden. Denn sie beruhen auf falschen Annahmen. Sie haben den Menschen überschätzt in seiner Rationalität. Und sie haben ihn gleichzeitig unterschätzt, als sie ihm ein simples egoistisches Gewinnstreben andichteten. So einfach ist das nämlich nicht.
So gibt es zum Beispiel Situationen, in denen Menschen Geld ausgeben, um einen anderen zu bestrafen, von dem sie sich ungerecht behandelt fühlen - auch dann, wenn sie wissen, dass sie den anderen nie wiedersehen werden. Aus finanzieller Sicht ist das vollkommen unsinnig. Verhaltensökonomen erklären es mit Reziprozität: Bist du bös zu mir, so bin ich bös zu dir.
Eine zweite Erklärungsmöglichkeit ist, dass wir neben unserem eigenen Vorteil zusätzlich die Fairness lieben. Dafür spricht eine weitere Beobachtung. Gibt man zwei Menschen gemeinsam 10 Dollar und erlaubt einem von ihnen, mit dem Geld zu verfahren, wie er mag, dann gibt er in der Regel dem anderen etwas ab. Das gilt auch, wenn die Menschen sich nicht kennen, ja es gilt sogar, wenn sie sich nicht einmal sehen können.
Dieses sogenannte Diktatorspiel ist eines der berühmtesten Experimente der neuen Ökonomie. Was früher unglaublich schien, als die Volkswirtschaft sich eher für eine philosophische denn für eine empirische Wissenschaft hielt, ist mittlerweile Wirklichkeit: Ökonomen rund um die Welt forschen im Labor. Ihre erstaunlichen Erkenntnisse werden jetzt sogar von der breiten Öffentlichkeit entdeckt. Derzeit erscheint in Deutschland erste populäre Literatur zum Thema. In Amerika steht "Predictably Irrational" seit Wochen auf den Bestsellerlisten. Diese Bücher haben nichts gemein mit dem alten Lamento allwissender Lehrmeister. Ihr Ton ist spielerisch. Die Volkswirtschaft ist menschlich geworden.
Uwe Jean Heuser: "Humanomics", Campus 2008.
Dan Ariely: "Predictably Irrational", Harper Collins 2008.
Hanno Beck: "Die Logik des Irrtums", Frankfurter Allgemeine Buch, erscheint voraussichtlich am 17. März 2008.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main