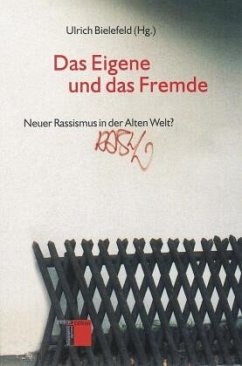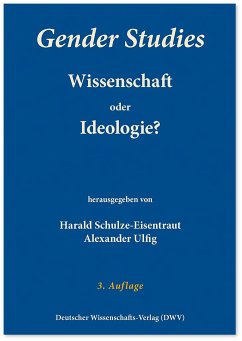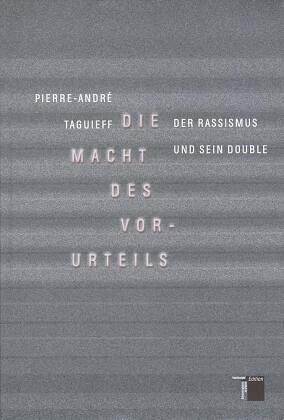
Die Macht des Vorurteils
Der Rassismus und sein Double
Übersetzung: Geese, Astrid
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
35,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das Erstarken einer Neuen Rechten in Europa erfordert die Überprüfung der Theorie und Praxis eines Antirassismus, der seinen Ausgangs- und Bezugspunkt immer noch im Nazismus hat.Pierre-André Taguieff bezweifelt, dass dieser Antirassismus eine erfolgreiche Strategie gegen rassistische Ideologie, Politik und rassistisches Handeln sein kann und versucht dies durch eine »Kritik der antirassistischen Vernunft« zu belegen. An die Stelle des Reiz-Reaktions-Schemas, das die Beziehung zwischen Rassismus und Antirassismus kennzeichnet und den Antirassismus hilflos macht, will der französische Sozi...
Das Erstarken einer Neuen Rechten in Europa erfordert die Überprüfung der Theorie und Praxis eines Antirassismus, der seinen Ausgangs- und Bezugspunkt immer noch im Nazismus hat.
Pierre-André Taguieff bezweifelt, dass dieser Antirassismus eine erfolgreiche Strategie gegen rassistische Ideologie, Politik und rassistisches Handeln sein kann und versucht dies durch eine »Kritik der antirassistischen Vernunft« zu belegen. An die Stelle des Reiz-Reaktions-Schemas, das die Beziehung zwischen Rassismus und Antirassismus kennzeichnet und den Antirassismus hilflos macht, will der französische Sozialphilosoph Grundlagen für reflektiertes Handeln setzen.
Handeln aber setzt Wissen voraus: Ohne eine Selbstanalyse des antirassistischen »Lagers« mit seinen Stereotypen und Ritualen und ohne Verständnis der Gründe für die Zählebigkeit des Rassismus in der Gesellschaft wird sich die Rivalitätsbeziehung zwischen den feindlichen Brüdern kaum beenden lassen.
Beschwörungen und einfache Umkehrung von Parolen helfen nicht gegen die Macht des Vorurteils, gegen Tendenzen der Ausgrenzung und hierarchisierenden Gruppenbildung. Nur ein Konzept für einen nicht-ideologischen Humanismus kann wirksam sein.
Pierre-André Taguieff bezweifelt, dass dieser Antirassismus eine erfolgreiche Strategie gegen rassistische Ideologie, Politik und rassistisches Handeln sein kann und versucht dies durch eine »Kritik der antirassistischen Vernunft« zu belegen. An die Stelle des Reiz-Reaktions-Schemas, das die Beziehung zwischen Rassismus und Antirassismus kennzeichnet und den Antirassismus hilflos macht, will der französische Sozialphilosoph Grundlagen für reflektiertes Handeln setzen.
Handeln aber setzt Wissen voraus: Ohne eine Selbstanalyse des antirassistischen »Lagers« mit seinen Stereotypen und Ritualen und ohne Verständnis der Gründe für die Zählebigkeit des Rassismus in der Gesellschaft wird sich die Rivalitätsbeziehung zwischen den feindlichen Brüdern kaum beenden lassen.
Beschwörungen und einfache Umkehrung von Parolen helfen nicht gegen die Macht des Vorurteils, gegen Tendenzen der Ausgrenzung und hierarchisierenden Gruppenbildung. Nur ein Konzept für einen nicht-ideologischen Humanismus kann wirksam sein.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.