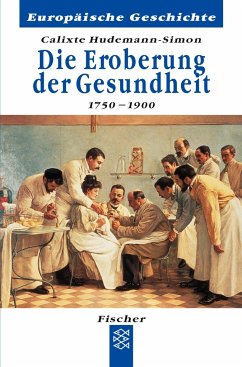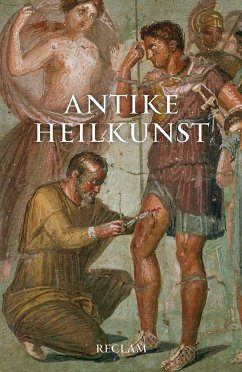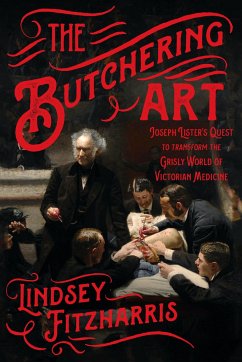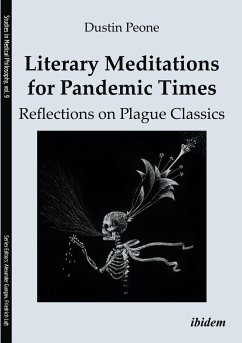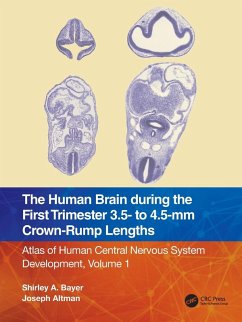Die Materialisierung des Ichs
Zur Geschichte der Hirnforschung im 19. und 20. Jahrhundert
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
24,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Materialisierung des Ichs beschreibt die konzeptionelle Entwicklung der Neurowissenschaften. Breidbach entfaltet nicht nur die Genese einer speziellen Naturwissenschaft, sondern beschreibt auch die Entwicklung eines Fragenkomplexes, der weit über den engeren Bereich einer Disziplin hinausreicht. Das Buch unternimmt den Versuch, nicht nur die Einzelantworten der Neurowissenschaften, sondern auch die damit verbundenen Konzepte aufzuzeigen und in ihrem historisch-philosophischen Kontext darzustellen. Diese historische Analyse erarbeitet die Voraussetzungen für ein umfassendes Verständnis d...
Die Materialisierung des Ichs beschreibt die konzeptionelle Entwicklung der Neurowissenschaften. Breidbach entfaltet nicht nur die Genese einer speziellen Naturwissenschaft, sondern beschreibt auch die Entwicklung eines Fragenkomplexes, der weit über den engeren Bereich einer Disziplin hinausreicht. Das Buch unternimmt den Versuch, nicht nur die Einzelantworten der Neurowissenschaften, sondern auch die damit verbundenen Konzepte aufzuzeigen und in ihrem historisch-philosophischen Kontext darzustellen. Diese historische Analyse erarbeitet die Voraussetzungen für ein umfassendes Verständnis der derzeitigen Positionen in den Neurowissenschaften.