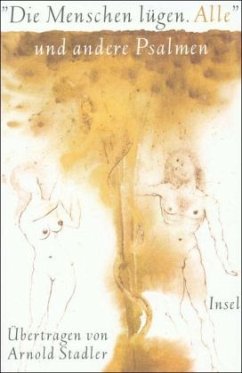"Mir verschlug es die Sprache, als ich erfahren musste: die Menschen lügen. Alle" - so steht es im Psalter des Alten Testaments, jener Sammlung von Hymnen, von Preis- und Dankliedern, Von Klage- und Vertrauensliedern. Die Psalmen sind 'moderne' Gedichte, ihre Poetik ist der Dynamik des Lebens abgelauscht.
Büchner-Preis-Träger Arnold Stadler legt eine Übertragung vor, die von der Faszination zeugt, die das Buch der Psalmen über dreitausend Jahre bis heute auf Dichter und Leser, Betende und Sänger ausgeübt hat. Er übersetzt die Psamlen in die Sprache der Gegenwart und ist ihnen zugleich treu geblieben, indem er ihre ursprüngliche Gedichtform beibehalten hat.
Büchner-Preis-Träger Arnold Stadler legt eine Übertragung vor, die von der Faszination zeugt, die das Buch der Psalmen über dreitausend Jahre bis heute auf Dichter und Leser, Betende und Sänger ausgeübt hat. Er übersetzt die Psamlen in die Sprache der Gegenwart und ist ihnen zugleich treu geblieben, indem er ihre ursprüngliche Gedichtform beibehalten hat.

Arnold Stadlers christliche Nachdichtung / Von Jakob Hessing
Die Kunst des Erzählers Arnold Stadler wird von der Intimität des eigenen Erlebens getragen. Der gute Zufall will es, dass er im Jahr des Büchner-Preises, der ihn ins Licht der Öffentlichkeit geholt hat, weitere Stücke einer inneren Biografie vorlegt: seine Nachdichtungen aus dem hebräischen Original des Psalters. Nach dem Studium der katholischen Theologie hatte er sich der Germanistik zugewandt, und in seiner Dissertation aus dem Jahre 1986 - "Das Buch der Psalmen und die deutschsprachige Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts" - gehen beide Neigungen eine Verbindung ein. An Brecht und Celan demonstrierte er zwei Varianten der Aneignung: die des Weltveränderers, der 1920 eigene "Psalme" schreibt, und die des Suchers, der nach der Katastrophe der Shoa in den Texten der Väter einem verlorenen Sinn nachspürt.
Jetzt werden die persönlichen Wurzeln eines scheinbar nur akademischen Interesses sichtbar. "Gerade die Einheitsübersetzung, mit der ich als Theologe arbeiten musste", schreibt Stadler am Ende seines Buches über das 1980 erschienene Gemeinschaftswerk der katholischen und der evangelischen Kirche, "hat mich zuweilen verstimmt. Gewiss, diese mehr oder weniger präzise Übersetzung war nicht für mich, sondern (im Prinzip) für alle, für die ganze Gemeinde der Gläubigen. Gut. Doch: Arme Gemeinde! Übersetzen heißt doch auch: zur Sprache bringen. Nicht zu Tode übersetzen, sondern in eine Sprache, die lebt." Mit dieser Hoffnung, das Tote wieder lebendig zu machen, spricht Arnold Stadler den existenziellen Wunsch aus, der alle bedeutenden Bibelübersetzungen - von Luther bis zu Moses Mendelssohn und Martin Buber - in Nachdichtung verwandelt. Der Christ wollte dem Volk aufs Maul schauen, um es in seiner eigenen Sprache zu Gott zu führen; die beiden Juden wollten ihrem Volk zunächst den Eintritt in die deutsche Kultur erleichtern und dann, kurz vor dem bitteren Ende, den Rückzug aus dieser Kultur. So überrascht es nicht, dass Stadler die Bibelübersetzung Martin Bubers als eine seiner Inspirationen für den Versuch benennt, in den biblischen Versen die eigene Sprache zur Sprache zu bringen.
Über dem Text, der das Buch einleitet, steht das lateinische Wort "Introibo". Es ist der katholischen Liturgie entnommen. Stadler erzählt aus seiner Ministrantenzeit: "Der Priester begann: Introibo ad altare Dei (,Zum Altare Gottes will ich treten'), und ich, sechsjährig, antwortete in Proskynese an den Stufen des Altars, vornüber gebeugt, es war in aller Herrgottsfrühe: Ad Deum qui laetificat iuventutem meam (,Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf'). - Jung war ich, das ist wahr, und ich verstand den auswendig aufgesagten Vers aus Psalm 43 gar nicht. Oder doch? Denn ich kann mich noch erinnern, dass ich die Worte als außerordentlich schön empfand, auch wenn ich sie nicht verstanden haben sollte." Auf der Suche nach dem wörtlichen Verständnis des einst nur als schön Empfundenen geht Stadler über die christliche Übersetzung in das hebräische Original zurück. Er ist seinen Lehrern dankbar. "Ich wüsste vielleicht gar nichts vom alten Sion, wenn nicht über die Vermittlung der Kirche, die sich ja als ,neues Sion' sah", heißt es am Ende der Einleitung. "Und von den Psalmen des alten oder eigentlichen Sion wüsste ich vielleicht auch nichts . . . Vielleicht gibt es auch hier, wie ja auch sonst im Leben, zwei - oder sogar noch mehr - Erben. Und wenn sich diese einander gelten ließen, so wäre dies das Schönste."
Lessing musste seinen Toleranzgedanken in eine Parabel fassen. Auch Stadler kommt nicht ohne den Konjunktiv aus. Denn dieser Gedanke trägt seine Schönheit, aber auch seine Schwierigkeit in sich. Es gehört zum Wesen der heiligen Texte, dass sie von ihrer Rezeption nicht zu lösen sind, durch diese Rezeption erst ,heilig' werden. Wie jeder Übersetzer nimmt deshalb auch Stadler ein Dilemma auf sich: Indem er sein Verständnis sucht, kommt er mit einer überkommenen Rezeption in Konflikt.
Er scheut diesen Konflikt nicht. Ein vieldeutiges Wort, "aschrej", leitet den Psalter ein. Im Deutschen, schreibt Stadler, wird es "mit ,wohl', ,gepriesen', ,selig', ,glücklich', ja mit ,Heil' wiedergegeben", er selbst aber wählt ein neues Wort. "Wunderbar der Mann, / der nicht aufs Volk hört, / den Leuten nicht nach dem Maul redet." Das ist ein anderer Ton, fern vom herkömmlichen "Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder." Man kann hier eine trotzige Umkehrung des Luther-Wortes heraushören, mehr noch Stadlers Bescheidenheit. Als Kollektivbekenntnis hat das erste Wort des Psalters immer auch bedeutet, dass man als Betender selbst zu den Gottgefälligen gehört, mit ihnen also ihr Glück und ihre Seligkeit teilt. Nicht so Stadler: Er bezeichnet den Gottgefälligen als "wunderbar", sieht ihn von außen und bewundert ihn nur, stellt sich nicht auf die gleiche Höhe mit ihm.
Stadler ist sich seines Heils nicht mehr sicher. Dennoch: Kann er, der die Bibel von Kindheit an mit den Augen des Christen gelesen hat, das Lebensgefühl der alten Hebräer nachempfinden, kann er sich die Erlösungssehnsucht ihres ursprünglichen, vorchristlichen Monotheismus aneignen? An seiner Wiedergabe von Psalm 137 lässt sich das überprüfen und eine psychologische Grenze des Toleranzgedankens ablesen: "An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten." Der Psalm erzählt vom babylonischen Exil und der Sehnsucht nach Jerusalem. Die Gefangenen sollen fröhliche Lieder singen, sie bringen aber nur Klagen und Flüche hervor; am Schluss verfluchen sie auch die Kinder Babylons: "Wohl dem (aschrej), der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert." Diesen letzten Vers, allzu blutrünstig, übersetzt Stadler nicht. Er hat den Psalter nur in Auswahl übertragen, etwa ein Drittel des Gesamttextes, und auch hier wählt er aus, nicht harmonisierend, aber humanisierend, im Sinne christlicher Gnade, nicht im Sinne althebräischer Rache. Das macht den Text freundlicher, wirft aber die Frage auf, ob Stadler die ursprüngliche Aussage dieses Psalms verinnerlichen kann. Die ersten vier Verse lauten bei ihm: "An den Flüssen von Babylon / saßen wir, weinten wir und sehnten uns / nach dem Zion. / Die Harfen hatten wir in die Weiden gehängt. / Doch unsere Herren verlangten Lieder von uns. / Wir wurden geschändet, und dazu sollten wir / auch noch singen. / ,Etwas Musik, bitteschön!' - / ,Zionslieder!' - / Wie hätten wir da singen sollen? / Die Psalmen! / Dazu noch in der Fremde! / Und doch." Stadler übersetzt diesen Psalm der Sehnsucht in seine Sprache des Alltags. Er nimmt ihm die Pathetik. Nimmt er ihm nicht auch einen Teil des Sinns? Hört der christliche Leser die Bedeutung dieses alten Zion, den Reichtum der Metapher, die alles einschließt - Heimat, Tempel, Gott? "Sollte ich", übersetzt Stadler den fünften Vers, "je vergessen dich, / mein Jerusalem! dann soll mir / die rechte Hand abfallen!" Im Hebräischen aber steht das Verb "tischkach", und es bedeutet "vergessen" - wenn der Sprecher dieser Verse Jerusalem vergisst, dann soll seine Hand nicht abfallen, sondern sie soll ebenfalls vergessen. Was soll die Rechte vergessen? In der Übersetzung Martin Bubers finden wir eine Antwort. Er fügt dem Verb ein Objekt hinzu. "Vergesse ich, Jerusalem, dein, / meine Rechte vergesse den Griff", den Griff nach der Harfe, mit der die Zionslieder begleitet, den Griff nach der Feder, mit der alle Psalmen aufgeschrieben wurden.
Kann der christliche Leser, für den der Erlöser bereits gekommen ist, dieser Hermeneutik folgen? Kann er sich mit den alten Hebräern vorstellen, dass die Gotteslieder des Psalters aus dem Gebot der Zionssehnsucht erwachsen sind, nicht aus der Gnade der Erlösung, sondern aus dem Schmerz des Verlustes? Vielleicht. Aber das sind die Fragen, die nie ein Ende finden werden, und mit jedem neuen Versuch, den Text zu begreifen, brechen sie wieder auf. Wo der Versuch so schön und unverblümt geraten ist wie bei Arnold Stadler, bildet er auch den Anfang eines neuen Gespräches.
"Die Menschen lügen. Alle und andere Psalmen". Aus dem Hebräischen übertragen und mit einem Nachwort versehen von Arnold Stadler. Insel Verlag, Frankfurt am Main 1999. 116 S., geb., 36,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Arnold Stadler, Büchner-Preisträger des Jahres 99, hat vor seinem Leben als Schriftsteller katholische Theologie und Germanistik studiert. Jakob Hesse verzeichnet ihn in seiner Rezension als einen jener deutschen Autoren, die Bibeltexte - hier die Psalmen - nicht einfach nur ins Deutsche bringen wollen, sondern dabei "dem Volk aufs Maul schauen", also versuchen, die religiöse Botschaft in ein Umgangsdeutsch zu übertragen. Stadler, so der Rezensent, verkürzt dabei, bringt nur eine Auswahl. Im Psalm 137 ("An den Wassern zu Babel") fehlt etwa der Vers, der den Kindern Babels den Tod wünscht. Eine Übertragung im Sinne christlicher Barmherzigkeit, und nicht althebräischer Rachetheologe sei das also, meint Hesse. Stadler harmonisiere nicht, sondern humanisiere.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"