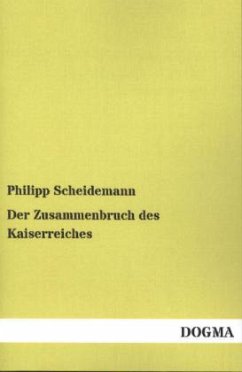Carl Schmitt hat in vielen Phasen seines Lebens Tagebuchaufzeichnungen gemacht. Nachdem er ab Februar 1915 als Kriegsfreiwilliger in München zunächst als Rekrut eine Grundausbildung erhielt, war er bald danach im Stellv. Generalkommando des I. bayerischen Armeekorps tätig. Dort leitete er bis 1919 ein Subreferat, das sich mit Genehmigung oder Verbot der Ein- und Ausfuhr von politisch brisanten Schriften, der Beobachtung der Friedensbewegung und der Verbreitung feindlicher Propagandatexte u. a. befasste. Die jetzt zum ersten Mal veröffentlichten Tagebucheintragungen gewähren wie die bereits publizierten aus der Zeit 1912 bis Anfang 1915 einen tiefen Einblick in seine damalige zerrissene Existenz zwischen spannungsreicher Ehe und zunächst als Bestrafung empfundenem Militärdienst, zwischen übersteigertem Selbstbewusstsein und armseliger Wirklichkeit. Vor allem sind die bislang fast unbekannten Dokumente aus der Militärbehörde, die in einer Auswahl auf etwa 140 Seiten abgebildet werden, für die Einschätzung des jungen Carl Schmitt und sein Verhältnis etwa zum Pazifismus unverzichtbar. Sie erlauben Einblicke in die "Werkstatt" seines Denkens, da gerade in dieser Zeit die ersten, später so berühmt gewordenen Werke "Politische Romantik" und "Die Diktatur" vorbereitet und in ersten Fassungen formuliert wurden. Bisher nicht bekannt sind auch die in der Rubrik "Aus dem Lager unserer Feinde" in der Hamburger Woche anonym veröffentlichten Artikel, die Carl Schmitt aus der Lektüre von ausländischen Zeitungen während seiner Dienstzeit zusammenstellte. Auch dieses Buch ist unverzichtbar für alle, die Neues über die frühe Formationsphase eines der produktivsten und einflußreichsten deutschen Gelehrten des 20. Jahrhunderts erfahren wollen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Mit Julien identifiziert: Carl Schmitts Tagebücher des Jahres 1915
Carl Schmitt wurde im Ersten Weltkrieg als Zensor verwendet. Die Freizeit verbrachte er in den Kneipen der Münchner Literaten. Seine Tagebücher zeigen einen Menschen, der mit der ganzen Welt im Krieg liegt.
"Ekel und Angst, Weihnachtsstimmung." Die Tagebuchnotiz Carl Schmitts ist nicht einfach zu deuten. Warum dachte er schon zweieinhalb Monate vor dem Fest, am 8. Oktober 1915, einem Freitag, an Weihnachten? Ein Topos heutiger Kulturkritik ist die Klage darüber, daß sich schon im Oktober die Lebkuchenschachteln im Supermarktregal stapeln. Man darf bei Schmitt durchaus ein analoges Gefühl annehmen. Die zu Weihnachten erzeugte Stimmung steht offenbar als Chiffre für die Verlogenheit einer bürgerlichen Welt, die ihre Rituale pflegt und im stolzen Bemühen um die im Kalender markierten Kulturwerte aus der Zeit gefallen ist.
Es war eine Nachmittagsgesellschaft im Münchner Haus des Malers Hugo Troendle, die Schmitt ins innere Weihnachtszimmer versetzte. Er traf bei Troendle den Dichter Theodor Däubler, "trank dort Tee und aß Kuchen". In Parenthese vermerkt er, daß er "Troendle fotografiert mit nackten Weibern" sah. Er war am Morgen zum Dienst angetreten, verließ das Büro aber schon um elf Uhr wieder. In der Neuen Börse am Maximiliansplatz hatte er zu Mittag gegessen, mit Troendle und mit seiner Frau, Cari, geborener von Dorotic, die er am 13. Februar in Köln nach seiner Einberufung als Kriegsfreiwilliger geheiratet hatte. Mit Däubler ging er von Troendle zu seinem Verleger Georg Müller, ohne daß sich seine Stimmung aufhellte. "Unterhalten; Däubler ist entsetzlich (ein quatschendes Weib)." Schmitt plante damals eine Monographie über den Dichter und mußte sich verspotten lassen, weil er angeblich der einzige war, der Däublers Epos "Nordlicht" ausgelesen hatte. Nach einem Abstecher ins Büro ("arbeitete etwas") aß er zu Hause mit seiner Frau zu Abend, traf sich dann aber noch einmal mit Däubler und seinem jüdischen Freund Georg Eisler im Lokal "Akropolis" an der Barer Straße.
Ein typischer Tag im Leben des Gefreiten Carl Schmitt, dessen Büro sich in der Herzog-Max-Burg befand, beim stellvertretenden Generalkommando des I. bayerischen Armee-Korps. Schmitt war als Referatsleiter für die Zensur von Druckschriften und die Überwachung der Friedensbewegung zuständig. Die Tätigkeit kam seinen Neigungen entgegen, ja war, auf dem Papier betrachtet, die Erfüllung eines Wunschtraums. Am 9. Juni 1915 notierte er: "Was ich mir oft heimlich wünschte, spionieren, überwachen, heimliche Macht, alles habe ich." Schon zwei Tage nach seinem Dienstantritt am 24. März hatte er gewußt, was er von seinem Vorgesetzten zu halten hatte. "Der Baron Freyberg ist sehr eifersüchtig und läßt einen nichts lernen, um alles in der Hand zu behalten. Aber heimlich weiß ich, daß ich doch allmählich der Beherrschende werde."
Ernst Hüsmert und Gerd Giesler haben ihrer Edition des Tagebuchs nicht nur eine Auswahl von Aktenstücken aus dem Zensurreferat beigegeben, sondern drucken auch kleine Schriften nach, die Schmitt im Krieg publizierte, darunter die bekannte Satire "Die Buribunken". Mit der Erfindung dieses originellen Völkchens hat Schmitt die Blogger unserer Tage vorweggenommen. Er karikiert seine historistisch gestimmten Zeitgenossen, die im Hochgefühl ihrer epochalen Bedeutung über ihr Leben Buch führen. Dabei kommt er auf Don Juan zu sprechen und weist Leporellos Register in der Gattungsgeschichte dieser Protokolliteratur den Platz eines bloßen Vorläufers an. Es fehlte dem Autor am Willen zur Macht. Sonst hätte Leporello nämlich "seine eigene Biographie geschrieben, er hätte sich selbst zum Helden gemacht und statt des so viele oberflächliche Gemüter faszinierenden, leichtfertigen Kavaliers hätten wir wahrscheinlich das imponierende Bild eines überlegenen Managers, der die buntfarbige Marionette Don Juan an den Fäden seiner überlegenen Geschäftskenntnis und Intelligenz herumzieht". Sollen wir auch Schmitt zu den oberflächlichen Gemütern zählen, weil wir aus dem Tagebuch erfahren, daß Grabbes Tragödie "Don Juan und Faust" ihn begeisterte?
Der Rechenschaftsbericht des Referatsleiters gibt uns nicht das imponierende Bild einer feldgrauen Eminenz, die den Generalmajor Baron von Freyberg als Paradeuniformpuppe an den Fäden ihrer überlegenen Intelligenz hätte zappeln lassen. Mit "ruhiger Überlegenheit" widmete Schmitt sich lediglich dem Plan, Selbstmord zu begehen. Er hatte Stendhals "Rot und Schwarz" gelesen. "Mit Julien identifiziert." Wenn Schmitt tatsächlich heimlich das Regiment im Büro führte, hat er diese Herrschaft sogar vor sich selbst verheimlicht. Der Eintrag vom 8. Oktober verzeichnet es als wundersam, daß Schmitt "überaus freundlich behandelt" wurde.
Die Beispiele für die von Schmitt bearbeiteten Eingaben könnten den Eindruck erwecken, daß er gar nichts zu entscheiden hatte. Ob die Herausgabe eines deutschfeindlichen Pamphlets an Thomas Mann verweigert wurde oder Rudolf Pannwitz den Rat erhielt, er solle Julius Meier-Graefe veranlassen, bei künftigen Sendungen die Umfangshöchstgrenze zu beachten - Schmitts Konzepte erschöpfen sich naturgemäß in der Montage bürokratischer Formeln. Es müßte aber, hätte man nur das Tagebuch und nicht auch diese objektiven Tätigkeitsnachweise, zweifelhaft sein, ob die Vorgesetzten in ein Zeugnis des 1916 zum Unteroffizier beförderten Beamten auf Widerruf auch nur den Satz "Routinearbeiten erledigte er zu unserer Zufriedenheit" hätten schreiben können.
Ekel und Angst sind die beherrschenden Motive auf sämtlichen Tagebuchseiten, und man müßte seitenweise zitieren, um eine Ahnung vom Alltag dieser Diktatur des Widerwärtigen zu geben. Die Angst erwartete Schmitt am Schreibtisch, denn der Traumjob des geheimen Mitlesers erwies sich als furchtbare Heimsuchung. "Oft erschrecke ich, wenn ich daran denke, wie ich inzwischen arbeite." Es war "zum Bangewerden". Tat er seine Pflicht, so ängstigte ihn das erst recht. Sozialpsychologisches Vokabular zur Analyse dieser Lage war zur Hand. "Wahnsinniger Wunsch nach Macht und Wirkung. Nervös, krankhafte Beamtenpsychose." Das Mitleid des Lesers wird sich, wie bei Lehrern, die der Krankenkasse melden, daß sie den Stress der Arbeit mit Kindern nicht aushalten, in Grenzen halten - obgleich sich in den Ekel gegenüber der Dienstpflicht die honorigsten politischen Motive mischen. Schmitt verschlang die eingeschmuggelten Flugschriften, deren Lektüre er seinen Landsleuten weisungsgemäß untersagte. Abscheu vor dem "Militarismus" und dem totalen Staat, der die moralische Existenz des einzelnen vernichtet, zieht sich durch das Tagebuch, hielt Schmitt freilich nicht davon ab, sich zu Weihnachten durch Treitschke-Lektüre aufrichten zu lassen. "Erinnerungen aus meiner Gymnasialzeit wirken dabei mit, ich fühle mich wieder wert, will streben und vorwärtskommen."
Schmitt verwirft den Krieg und den Staat, der nur für den Krieg existiert. Sich selbst beschreibt er als machtlos, und er müßte sich eigentlich, um die Frage abzuweisen, warum er nichts gegen den Krieg publiziert, unpolitisch nennen. Aber sogar dem Geständnis der Ohnmacht wirft er das Kostüm seiner Allmachtphantasie über: "Ich durchschaue den ganzen Schwindel, wie es Napoleon nicht richtiger und überlegener hätte durchschauen können. Aber ich habe nicht die Kraft, einer Ordonnanz einen Befehl zu geben."
Von seiner Gattin zu schweigen. Angst und Ekel hatten Schmitt im Griff, noch ehe ihn Post und Telegramme trafen. Daheim wiederholte sich das Elend, daß die Pflichterfüllung seine Selbstachtung zerfraß. In zwei besondere Gewaltverhältnisse sah er sich eingesperrt, deren Beziehung er als strengen Parallelismus wahrnahm: "Die Ehe und das Militär. In dieser schauderhaften Doppelklammer werde ich wohl zerrieben werden."
Natürlich deutete Schmitt sein häusliches Unglück politisch, klassifizierte Cari als "herrschsüchtig". Aber die psychopathologische Betrachtung, die Schmitt in den "Buribunken" als Verfallsform des bürgerlichen Geistes abtut, findet im Tagebuch ein überreiches Material, das durch solche Topoi der Ehekritik eher verdeckt wird. Als anthropologischer Grund der Unterscheidung von Freund und Feind erscheint auf dem Schlachtfeld dieses Lebens ein Bedürfnis nach Abstand, gegenüber dem alle politischen Setzungen sekundär sind, die dem Wunsch nach Distanzierung Rechnung tragen, ohne ihn erfüllen zu können. Die Erfüllung wäre identisch mit der Auflösung der Gesellschaft. Allein steht der Mensch, wie Schmitt 1917 in seinem Aufsatz über die Sichtbarkeit der Kirche darlegt, erst im Jüngsten Gericht da.
Die Metaphern, mit denen Schmitt die feindlichen Erscheinungen seiner äußeren und inneren Welt sortiert, sind nicht politischer, sondern soziologischer Herkunft. Am häufigsten fällt das Wort "Prolet". Schmitt ist in der Kaserne, im Büro und in der Schriftstellerkneipe von Proleten umgeben. Er hat eine soziale Erklärung dafür, daß er vergeblich nach der Macht des Hinterzimmermannes strebt. "Ich fühle doch, wie ich ein Unterschichtenkerl, ein schlauer, listiger Mitmensch bin; überlegend, aber nicht überlegen." Als "armer Prolet" sieht er sich verdammt, seine Frau zu demütigen, die im Zweifel immer noch empfindlicher reagiert, als er vorausahnt. "Wäre ich ein Hochstapler, ginge es mir besser diesen seelischen Feinheiten gegenüber." Die Hochstaplerin war Cari, die sich als Adelige ausgegeben hatte. 1922 soll Schmitt sie als Betrügerin erkannt haben, woraufhin sie aus seinem Leben verschwand. Die Umstände des Bluffs liegen im dunkeln, aber es ist frappant, daß der Jurist sich in diesem Punkt, einer Formsache im strengsten Sinne, irreführen ließ.
Die wenigsten Leser der "Buribunken" werden vermutet haben, daß der anonyme Verfasser selbst Tagebuch geführt hatte. Wenn Schmitt von aller historistischen Selbstanalyse absieht, gereicht dies dem Eindruck, den wir von seinem Charakter empfangen, leider nicht zum Vorteil. Schon am Anfang seiner Karriere bilden Selbstanklage und Selbstverteidigung ein unentwirrbares Syndrom. Daß man auf das Urteil anderer Menschen Rücksicht nimmt, ist in Schmitts Augen keine humane Selbstverständlichkeit, sondern die Erbsünde der strebsamen Proleten, mit einem Synonym: der Juden.
Mozart hätte eine Leporello-Oper schreiben können. "Aber statt die Feder in die Hand zu nehmen, ballt der arme Teufel die Faust in der Tasche." Schmitt zog die Faust aus der Tasche und schrieb Tagebuch. Das Bild, das er abgibt, ist jämmerlich.
PATRICK BAHNERS
"Carl Schmitt. Die Militärzeit 1915 bis 1919". Tagebuch Februar bis Dezember 1915. Aufsätze und Materialien. Herausgegeben von Ernst Hüsmert und Gerd Giesler. Akademie Verlag, Berlin 2005. 588 S., geb., 49,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Auch wenn er von den "erschreckend schlichten Grundmustern" des Denkens von Carls Schmitt eher befremdet ist, eines muss Thomas Assheuer dem "Kronjuristen des Dritten Reichs" doch zugestehen. Schmitt nehme kein Blatt vor den Mund und berichte in "radikaler Offenheit" von seinem als hoffnungslos empfundenen Leben. Zwei Problemfelder tauchen immer wieder im vorliegenden zweiten Band der Tagebücher auf. Der verhasste Militärdienst, zu dem er sich freiwillig gemeldet hatte und die schwierige Ehe mit der angeblichen Adligen Carl von Dorotic. Assheuer sieht in den Tiraden Schmitts schon den "maßlos verächtlichen Ton" anklingen, den er von den späteren Schriften kennt. Überhaupt passen einige biografische Begebenheiten erstaunlich gut zu den Theorien, die der Rechts- und Politikwissenschaftler später entwerfen sollte. Die Herausgeber lobt Assheuer für ihre "sorgfältige" Arbeit, attestiert ihnen aber auch eine zu große "geistige Nähe" zu ihrem Subjekt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Was den zweiten Band der Tagebücher neben diesen flackernden Tagebuchnotaten zu einem Ereignis macht, sind die angehängten Dokumente aus der Zensurbehörde." Süddeutsche Zeitung, 11. März 2006 "Fast alle Vorurteile über Carl Schmitt stellen die beiden ersten, unlängst im Akademie Verlag erschienenen Tagebuchbände aus der Zeit um den ersten Weltkrieg auf den Kopf." Taz, 16. März 2006 "Carl Schmitt wurde im Ersten Weltkrieg als Zensor verwendet. Die Freizeit verbrachte er in den Kneipen der Münchner Literaten. Seine Tagebücher zeigen einen Menschen, der mit der ganzen Welt im Krieg liegt." Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. Dezember 2006 "Die Dokumente [sind] unter wissenschaftlichen Kriterien vorzüglich kommentiert und mit ausführlichen Anmerkungen versehen." Hans-Erich Volkmann in: Militärische Zeitschrift, Jhrg. 66, Heft 1 (2007)