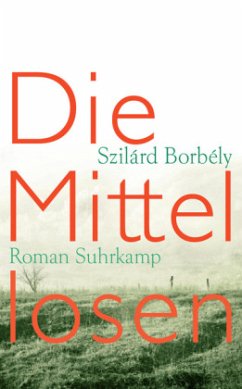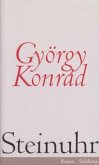Als der Ladenbesitzer Mózsi von der Zwangsarbeit ins Dorf zurückkehrt, hat er keine Ähnlichkeit mehr mit einem Juden. Er wird nie wieder einen schwarzen Kaftan tragen. Auch kein weißes Hemd. Er fragt nicht, wohin seine Ware sich verflüchtigt hat: "Aus dem Haus sind die Möbel verschwunden, aus den Regalen die Bücher, aus den Herzen das Erbarmen."
In diesem Dorf wächst Jahrzehnte später, in den 1970er Jahren, ein Junge auf, der Erzähler des Romans. Der Elfjährige muss schwere körperliche Arbeit verrichten, er friert und hungert. Nur in der Beschäftigung mit den Primzahlen findet er sich selbst - und etwas wie das Glück der Distanz. Mit seiner älteren Schwester versucht er, die Mutter vom Suizid abzuhalten. Der Vater, Traktorist in einer LPG, versäuft das Geld und prügelt. Die Familie ist stigmatisiert. Über die Vergangenheit darf nicht geredet werden. Sind sie Juden? Aus Rumänien vertrieben orthodoxe Christen? Warum werden sie ausgegrenzt?
Borbély schildert Kindheitsszenen in einer verrohten Welt. Aber er schildert sie so, dass man mit stockendem Atem liest und nicht aufhören kann. In der Selbstbeobachtung des Außenseiters wächst dem Jungen ein unerhörter Scharfblick zu. Wohl nur Imre Kertész und Agota Kristof haben vergleichbar lakonisch und luzide vom Überleben erzählt.
In diesem Dorf wächst Jahrzehnte später, in den 1970er Jahren, ein Junge auf, der Erzähler des Romans. Der Elfjährige muss schwere körperliche Arbeit verrichten, er friert und hungert. Nur in der Beschäftigung mit den Primzahlen findet er sich selbst - und etwas wie das Glück der Distanz. Mit seiner älteren Schwester versucht er, die Mutter vom Suizid abzuhalten. Der Vater, Traktorist in einer LPG, versäuft das Geld und prügelt. Die Familie ist stigmatisiert. Über die Vergangenheit darf nicht geredet werden. Sind sie Juden? Aus Rumänien vertrieben orthodoxe Christen? Warum werden sie ausgegrenzt?
Borbély schildert Kindheitsszenen in einer verrohten Welt. Aber er schildert sie so, dass man mit stockendem Atem liest und nicht aufhören kann. In der Selbstbeobachtung des Außenseiters wächst dem Jungen ein unerhörter Scharfblick zu. Wohl nur Imre Kertész und Agota Kristof haben vergleichbar lakonisch und luzide vom Überleben erzählt.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Die Perspektive des Elfjährigen, die Szilárd Borbély für seinen Roman "Die Mittellosen" gewählt hat, gibt dem Buch eine anthropologische Tönung, findet Ina Hartwig. Der Junge schildert die Enge des ungarischen Dorflebens, wo jeder, der über das Dorf spricht oder es verlässt, als Verräter geächtet wird, und jeder, der "nicht dort stirbt, wo er geboren wurde" und eine Spur zu intelligent ist, als Jude gilt und Anfeindungen ausgesetzt ist, fasst die Rezensentin zusammen. Und dennoch gelingt es weder dem Großvater, der "das absurde Vokabular des Sozialismus" verweigert, noch der Mutter, die kaum lesen kann und häufig droht, sich umzubringen, das Dorf zu verlassen, berichtet Hartwig. Erst der Erzähler schafft den Aufbruch, dem Gymnasium sei Dank, verrät die Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Szilárd Borbélys kunstvoller und verstörender Roman "Die Mittellosen" erzählt vom Elend in den abgelegenen Dörfern Ungarns
"Ich schreibe über Armut, weil ich beobachte, dass arme Leute immer gleichgültiger und schlechter behandelt werden", sagte der ungarische Schriftsteller Szilárd Borbély. "Würde ich heute aufwachsen, es würde mir wohl kaum gelingen, aus der Armut rauszukommen. Diese Tatsache zerfrisst mir das Herz und macht mich zornig." Als der Lyriker und Essayist vor einem Jahr in Ungarn seinen ersten Roman veröffentlichte, kam das einer Sensation gleich. Niemand hatte vorher so schonungslos und zugleich so formvollendet über das Elend in den abgelegenen Dörfern Ungarns geschrieben. Gleichzeitig lässt der Roman ahnen, warum in der ungarischen Gesellschaft die Sprache der Gewalt so bewundert wird, die skrupellosesten Politiker am meisten Erfolg haben und ein neuer Antisemitismus um sich greift.
Der 1964 im nordöstlichsten Winkel Ungarns geborene Autor erzählt von seiner Kindheit in einem aus der Zeit gefallenen Dorf. Der kindliche Erzähler ringt mit den Worten, setzt immer wieder neu an und kreist unnachgiebig und sachlich um seine Gegenstände: Die Sätze gleichen chirurgisch präzisen Schnitten, und ihr strenger Rhythmus verstärkt nur den Schrecken dessen, was sie beschreiben. Weil dabei auch die Chronologie aufgelöst wird, entsteht eine ausweglose, absolute Gegenwart, in der die Toten lebendig und die Lebenden immer schon tot sind.
"Warum habe ich das Gefühl, keine Erinnerungen zu haben?", fragt sich der Autor, als ihm bewusst wird, wie viel aus dieser Zeit er jahrzehntelang verdrängt hat. Mit den blinden Augen eines traumatisierten Kindes hatte er diese grausame Welt gesehen, in der es kein Mitleid und keine Gnade, keine Großherzigkeit und keine Versöhnung gab. Und doch lässt sich der Roman als vorsichtige Liebeserklärung an die Mutter lesen, die ihn und seine Schwester mit ihren seltenen Liebkosungen und vor allem mit der Erlaubnis zu träumen gerettet hat. Die Bauern trieben ihren Kindern das Träumen aus, indem sie neben den Schlafenden eine Katze erschlugen: deren Todesqual sollte in die kindlichen Träume eindringen und sie zerstören.
Die Schläge und das Schreien der Mutter verschweigt der Erzähler nicht, auch nicht ihre angedrohten und versuchten Selbstmorde, die er und seine Schwester abwechselnd verhindern, indem sie sich an ihre Beine klammern. "Dass auch du endlich krepierst, hol dich die Pest", schreit seine Mutter, während sie mit dem stinkenden Putzlappen auf ihn einschlägt - die Strafe, die er am meisten verabscheut.
Der Geruch der Armut, die Mischung aus Fäkalien und Schlamm, Blut und Verwesung schüttelt ihn bis zum Erbrechen. Als er eines Tages eine ausgemergelte Katze bei dem vergeblichen Versuch beobachtet, einen lebenden Frosch hinunterzuwürgen, ekelt er sich und kann die Augen doch nicht abwenden. Das Ekelgefühl, eines der stärksten Selbsterkundungs- und Distanzierungsgefühle überhaupt, prägt den freudlosen und vor allem schweigenden Alltag des Kindes. Im Haus und bei der Arbeit durften die Kinder nicht sprechen, es wurde ihnen auch nichts erklärt: Wie die Hunde wurden sie mit Stockhieben abgerichtet.
Borbély hat eine kunstvoll kalte, in ihrer Strenge hochpoetische Sprache gefunden, um gegen das Verstummen anzuschreiben. Und dort, wo er bewusst schweigt, spricht der Schmerz, wie bei Agota Kristof, am lautesten. Nur der Zigeuner Messias, neben der Mutter die zweite Lichtgestalt des Romans, traut sich, laut zu weinen, wenn er gequält wird. Ihm hat der Autor, von Heike Flemming und Laszlo Kronitzer brillant übersetzt, eines der eindrucksvollsten Kapitel gewidmet. Es spielt an der "Rampe", dem Zentrum des Dorfes, wo die amtlichen Bekanntmachungen angeschlagen werden und in der Kneipe die Männer ihre Abende verbringen. Dass der Wirt Geheimdienstspitzel ist, akzeptieren alle, trotzdem wird gesoffen, geprügelt und geschimpft, die Bauern kuschen vor den Kommunisten und hassen sie gleichzeitig. Wie unter einem Vergrößerungsglas zeigen sich hier Verrohung und Feigheit, das grausam ausgeübte Recht des Stärkeren und die Lust am Quälen von Mensch und Tier, so fein choreographiert und kalt leuchtend wie in Lars von Triers Film "Dogville". Dort hören wir nach dem finalen Massaker nur noch das Gebell des Hundes Moses, des heimlichen Helden - und es ist kein Zufall, dass in Borbélys archaischem, als modernes Gleichnis erzähltem Dorf jeder Hund Zigeuner heißt und der besonders übel riechende Zigeuner Messias, der die Plumpsklos leert, dem Kind zum unfreiwilligen und unwissenden Erlöser wird.
Die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich tief ins Bewusstsein der Dörfler eingegraben, sie haben gemeinsam das Haus der deportierten jüdischen Kaufmannsfamilie Mózsi geplündert und schweigend die Rückkehr des Vaters in das leere Haus beobachtet. Noch um 1970, der erzählten Zeit des Romans, darf man das Wort Jude nicht aussprechen, "meine Schwester flüstert es manchmal ..., und ich ersticke fast, wenn man von den Juden redet". Sein Vater, so das Gerücht, soll einen jüdischen Vater haben, dem Jungen ruft man "Drecksjude" nach, und die Mutter, um ihre jüdischen Spielkameraden trauernd, zündet am Schabbat eine Kerze an und liest aus ihrem Buch mit "den eckigen Buchstaben" vor. "Sie machen uns zu Juden", erklärt die Mutter hellsichtig, obwohl sie nicht versteht, warum man die Familie ausgrenzt: Weil sie Ruthenen sind? Huzulen? Rumänen? Die Großmutter erzählt immer andere Geschichten über ihre Herkunft, während der Großvater, früher Offizier und glühender Horthy-Anhänger, erfundene Judenrettungsgeschichten beisteuert.
Die in Frage gestellte, verdrängte und neu erschriebene Identität und die Erinnerung als "Mischung aus Fiktionen, Lügen, Selbstmitleid und Bedauern, Angst und Argwohn" sind die Grundthemen von Borbélys so ernstem wie stilbewusst-spielerischem Werk, sie prägen vor allem die nach dem Tod seiner Mutter bei einem Raubüberfall entstandenen Gedichte. Der Vater überlebte schwer verletzt und starb Jahre später in der Psychiatrie. "Als ich anfing, die Welt meiner Eltern und die des Dorfes zu schildern, stellte ich erstaunt fest, dass ich sie mit dieser Schilderung verriet", notierte er nach Abschluss des Romans. Der kindliche Erzähler, sein Alter Ego, zählte auf seinen Wegen alles, was er sah, und tröstete sich mit der schicksalhaften Einsamkeit der Primzahlen, doch den erwachsenen Autor, dessen analytische Stimme wir hören, holten die alten Dämonen wieder ein. "Ich hatte gedacht, über all das kann ich schon schreiben, es liegt weit zurück, verheilte Wunden", schrieb er im Februar dieses Jahres seiner Übersetzerin. Kurz darauf nahm er sich das Leben.
NICOLE HENNEBERG
Szilárd Borbély: "Die Mittellosen". Roman.
Aus dem Ungarischen von Heike Flemming und Laszlo Kronitzer. Suhrkamp Verlag, Berlin 2014. 250 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Die Gegenwärtigkeit der Szenen verknüpft Borbély unfassbar leise mit dem Nachdenken darüber, so dass die Traurigkeit der Mittellosen eine woyzeckhafte Abgrundtiefe bekommt. Der Roman dürfte das Buch des Herbstes darstellen, der ganz selbstverständlich den Anschluss an die Weltliteratur findet. Verhaftet an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Leben, von dort aus jedem Leser der Welt etwas vom Unglück des Menschen zurufend."
Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau 07.10.2014
Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau 07.10.2014
»Die Mittellosen, in dieser ausgezeichnet lesbaren Übersetzung aus dem Ungarischen, gehören zu den ganz wichtigen Büchern der Gegenwart. Dieser Roman ist wichtiger als so manches Hochgerühmte.« Ina Hartwig DIE ZEIT 20150401