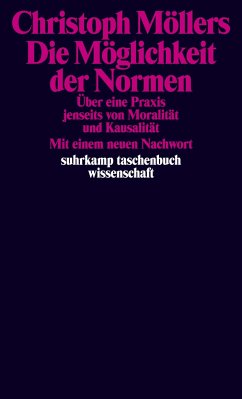Normen, so könnte man meinen, verlangen stets bestimmte Handlungen oder Unterlassungen und erfordern eine moralische Rechtfertigung. Christoph Möllers bestreitet das und behauptet, dass unser Umgang mit Normen an falschen Erwartungen leidet. Wir überfordern die Praxis des Normativen mit moralischen Ansprüchen und mit Hoffnungen auf Wirksamkeit. In seinem vieldiskutierten Buch entwickelt Möllers eine neue Sicht auf Normen und zeigt, welchem Zweck sie wirklich dienen. Darüber hinaus befasst er sich im neuen Nachwort zu dieser Ausgabe mit kritischen Einwänden gegen seine Theorie.
» ... ein hinreißendes Buch.« Rainer Forst DIE ZEIT 20160114
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Welches ist der Berufsstand, dessen Lieblingssujet Normen sind? Richtig, Juristen! Aber Rezensent Rainer Forst, obwohl Politologe und Philosoph, liebt dieses Sujet auch sehr, und als Leser seiner Kritik hat man den Eindruck: Hier sind zwei unter sich, und man sollte sie besser nicht stören. Als einen Romantiker feiert Forst Christoph Möllers, und dies - soweit man folgen kann - weil er Normen als Markierung von Möglichkeiten sieht, und keineswegs als ein Instrument das Handlungsmöglichkeiten verschließt. Diese "dunkle Seite der Normen", so wiederholt Forst mehrfach in seiner Kritik komme bei Möllers zu kurz. Er kann ihm darum den Vorwurf eines gewissen Reduktionismus nicht ersparen. Aber so sei es mit der Romantik, sie sei eben zu überschwänglich. Hinreißend!
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Opus magnum: Christoph Möllers, gerade mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet, sondiert den Anspruch von Normen
Kant sah die Probleme der praktischen Philosophie noch in der Frage "Was soll ich tun?" zusammenlaufen. Der Kampf um ihre Beantwortung ist allerdings seit geraumer Zeit in der Tristesse des Stellungskriegs erstarrt. Die streitenden Parteien - Kantianer auf der einen, Konsequentialisten auf der anderen Seite, dazwischen noch einige versprengte Trupps von Aristotelikern und Hegelianern - haben sich im schweren Boden ihrer Gewissheiten eingegraben. Von Zeit zu Zeit überziehen sie den Gegner mit einem publizistischen Sperrfeuer, bisweilen erobern sie einen Graben in Gestalt eines Lehrstuhls oder eines Gremiensitzes, aber entscheidende Durchbrüche an der Wahrheitsfront sind nicht zu erwarten.
Der frischgebackene Leibniz-Preisträger Christoph Möllers wählt für sein Opus magnum "Die Möglichkeit der Normen" denn auch einen anderen, weniger stark vorbelasteten Ausgangspunkt. Statt sich an dem Problem abzuarbeiten, wie eine Norm sein sollte, widmet er sich der systematisch vorgelagerten Frage, was eine Norm ist. Als Jurist ist Möllers besonders an sozialen Normen interessiert, an Normen also, die nicht lediglich im Inneren der einzelnen moralischen Subjekte ihr Werk tun, sondern deren äußeres, gesellschaftlich wahrnehmbares und bewertbares Verhalten betreffen.
Möllers' Ziel besteht darin, "einen begrifflichen Rahmen für soziale Normen zu entwickeln, der hinreichend weit für unterschiedlichste Phänomene ist, ohne konturenlos zu werden". Diesen Rahmen findet Möllers in einem Normbegriff, der auf den ersten Blick so unscheinbar wirkt, dass der Leser sich angstvoll fragt, wie sich mit seiner Erläuterung vierhundertfünfzig Seiten sollen füllen lassen. Wer sich davon nicht Bange machen lässt, wird allerdings auf das angenehmste enttäuscht. Möllers brennt ein solches Feuerwerk an Analysen und Thesen ab, dass die Lektüre seines Buches streckenweise einem intellektuellen Abenteuerurlaub gleicht.
Eine Norm ist, wie Möllers herausarbeitet, "die Affirmation der Verwirklichung einer Möglichkeit". Sie lässt sich weder auf den Status eines Instruments zur Erreichung bestimmter sozialer oder politischer Zwecke noch auf den eines von jeder sozialen Verkörperung unabhängigen guten Grundes reduzieren. Ginge es nur um möglichst effiziente Zweckerreichung, so wäre es besser, eine den Ausschluss alternativer Verhaltensmöglichkeiten bezweckende kausalistische Strategie zu verfolgen, statt das Risiko einzugehen, Normen zu setzen, die bekanntlich nicht nur befolgt, sondern auch gebrochen werden können. Wäre die Rolle von Normen umgekehrt nur diejenige guter Gründe, so würde dadurch die Funktionsweise realer sozialer Praktiken verzerrt, deren Normen "einen Ort, eine Zeit, eine Darstellungsform" im gesellschaftlichen Raum benötigen und deren Legitimationsansprüche in spezifischer Weise begrenzt sind.
So geht es, wie Möllers gegen Habermas geltend macht, im Rahmen juridischer Verfahren nicht nur darum, gute Gründe zum Zug kommen zu lassen, sondern auch darum, den Kreis der entscheidungsrelevanten guten Gründe sachlich und zeitlich zu beschränken.
Für Möllers liegt die zentrale Leistung von Normativität nicht in Steuerung oder Begründung, sondern - viel grundsätzlicher - in der Bezeichnung und Sichtbarmachung von Alternativen zum bestehenden Weltzustand. Wenn Jesus, nachdem er seine Jünger daran erinnert hat, wie die Herrschenden mit ihrer Macht umzugehen pflegen, fortfährt: "Bei euch soll es nicht so sein!", so macht er damit den Ausgangspunkt jeder normativen Praxis deutlich. Dieser besteht in der "Möglichkeit, sich der Wirklichkeit zu verweigern", also nicht einfach alles so hinzunehmen, wie es ist. Ebenso wie Hegel, dessen philosophisches System seine Dynamik der Figur der konkreten Negation verdankt, weiß auch Möllers: "Die Grundoperation des Normativen ist negativ. Sie weist die Welt so, wie sie ist, zurück." Die Affirmation als das zweite Begriffsmoment des Normativen baut stets auf dieser basalen Negation auf. Über die reine Möglichkeit des Andersseins geht sie insofern hinaus, als sie eine bestimmte Möglichkeit mit einem Verwirklichungsanspruch belegt. "Wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein."
Normativität ist demnach eine soziale Praxis, in der sich eine Gesellschaft von ihrer eigenen Realität distanziert; sie stellt "eine Gegenwelt als Teil der Welt" dar. Dies ist nicht ohne Risiko. Durch die ihnen innewohnende Unterscheidung zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte und sollte, wirken Normen potentiell destabilisierend. In besonderer Weise gilt dies im Rahmen demokratischer Verfassungsordnungen. Diese setzen nämlich nicht nur Normen so wie andere politische Systeme auch, sondern sie verstehen sich, wie Möllers hervorhebt, zudem "als Ordnungen, deren normativer Anspruch nicht erfüllt ist und letztlich nicht erfüllt werden kann"; die wahre Demokratie gibt es nur im Irrealis. In Demokratien ist es deshalb üblich, die eigenen demokratischen Defizite zu kritisieren; nicht zuletzt dadurch unterscheiden sie sich von autoritären oder traditionalen Systemen.
Dieses Destabilisierungsrisiko nehmen Demokratien um der Freiheit willen jedoch sehenden Auges in Kauf. Abweichung ist in ihnen deshalb nicht etwa ein notwendiges Übel, sondern sie ist geradezu ihr Lebenselixier. Zu Recht führt Möllers aus: "Zu viel wird in der politischen Theorie über Gemeinsamkeit und Zusammenhalt nachgedacht. Dabei entstehen Gefährdungen demokratischer Ordnungen dadurch, dass Möglichkeiten zu abweichendem Verhalten faktisch ausgeschlossen werden." Wenn in einer politisch existentiellen Frage wie dem Flüchtlingsproblem die Überzeugungen eines großen Teils der Bevölkerung pauschal als "rechts" etikettiert und die Betreffenden dadurch de facto mundtot gemacht werden oder wenn, wie in der Euro-Krise, die Rhetorik der Alternativlosigkeit jegliche Gegenposition als verantwortungslos brandmarkt, so markieren derartige Methoden der Auseinandersetzung einen in seinen Wirkungen noch nicht absehbaren Abschied von Möllers' Modell demokratischer Normativität.
Wer sich zu Beginn von Möllers' Buch fragte, wozu dessen "nicht-normative Theorie des Normativen" gut sein solle, der kennt spätestens jetzt die Antwort. Indem Möllers aufdeckt, welche Konsequenzen theoretische Vorannahmen für die Praxis haben, hält er nicht nur Theorien den Spiegel vor, die an den Eigenarten sozialer Praktiken vorbeigehen, sondern auch einer Praxis, die den kulturellen Wert reflektierter sozialer Selbstinfragestellung allzu gering achtet. So gesehen, ist Möllers' Normkonzeption institutionell ebenso wenig unschuldig, wie er es den Vertretern abweichender Normativitätsverständnisse vorwirft. Aber es ist eine wohlbegründete Schuld: der Preis unserer bisherigen Lebensform.
MICHAEL PAWLIK.
Christoph Möllers: "Die Möglichkeit der Normen". Über eine Praxis jenseits von Moralität und Kausalität.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2015. 464 S., geb., 34,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main