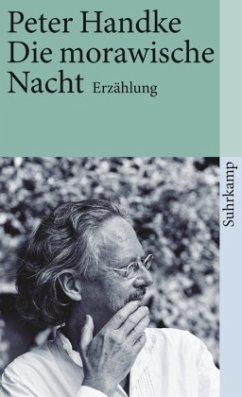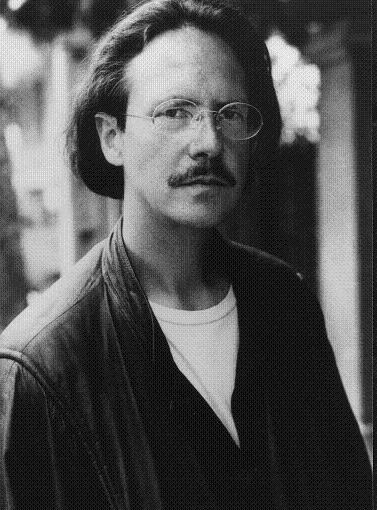In einer Neumondnacht lädt ein "ehemaliger Autor" die Freunde seines Lebens auf sein Hausboot am Ufer der Morawa, einem serbischen Nebenfluß der Donau, um ihnen eine Geschichte zu erzählen. Sie führt zu den Orten, an denen alles begann, sie erzählt seine Lebensreise durch Europa. Kritik und Publikum reagierten begeistert auf Peter Handkes märchenhafte Bilanz eines Dichterlebens.
»Ein wunderliches, gelegentlich auch wundersames Buch, das nicht nur eine vielschichtige und vieldeutige Rückschau auf Handkes bisheriges poetisches Universum ist, sondern erzählerisch eine ironisch gebrochene Utopie inszeniert, die auf eigenen Erfahrungen und Anschauungen basiert. Und wo kämen wir hin ohne eine Literatur, die das in steter Beharrlichkeit immer neu versucht.«
Cornelius Hell, Die Furche
Cornelius Hell, Die Furche
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Als "selbstironische Bilanz (s)eines Dichterlebens" würdigt Andreas Breitenstein das neue Werk Peter Handkes, das ihn rundum überzeugt. Die Erzählung um einen ehemaligen Autor, der auf der Suche nach seinem verlorenen Selbst durch Europa reist, das Grab seines Vaters und seiner Mutter besucht, seinen Bruder, Politiker, Schulkameraden, Dichterkollegen trifft und mit Romanfiguren spricht, um am Ende wieder zu seinem Hausboot "Morawische Nacht" in Porodin zurückzukehren und mit Freunden zu feiern, nimmt nach Ansicht Breitensteins den entspannten Ton des Vorgängerwerks "Kali" auf, um ihn weiterzuführen Richtung "Revision und Versöhnung". Er würdigt die "gedankliche Reife" und "epische Weite" des Werks, das sich durch wunderbare Reise-Episoden, Meditationen und Alltagsbeobachtungen, autobiografische Erinnerungen und poetologische Reflexionen auszeichnet. Und nicht zuletzt findet er in dem Buch auch eine selbstironische Selbstprüfung Handkes.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Peter Handke verabschiedet sich vom Balkan
Peter Handkes neues Buch "Die morawische Nacht" treibt die bösen Gespenster der letzten Jahre aus.
Das wäre doch schön: ein Buch, in dem beinahe nichts geschieht. Ein flüchtiges Buch, das in den Zwischenräumen lebt, zwischen den Zeilen, wie man so sagt, zwischen den Wörtern und den Buchstaben. Ein Buch, in dem man anstreichen kann beim ersten Lesen, unendlich viel anstreichen; und alles, was man angestrichen hat, die Signalwörter, die Skandalwörter, erweist sich dann, beim zweiten Lesen, als leer und nichtig, im Grunde überflüssig. Die Anstrichworte heißen zum Beispiel "Balkan" und "Krieg" und "zwischen den Kriegen" und "vereintes Europa", "Schuld" und "Amok", immer wieder "Amok" und "Gewalt".
Stattdessen bleibt das Nichtige. Eintagsfliegen, die einen Tag lang leben, wie auch sonst? Ein Himmel in Blau, eine Leserin, die einen Autor zupft, um sich zu vergewissern, dass es ihn gibt. Ein Buch auf einem Haufen Sperrmüll. Ein Erzähler, der Brombeeren isst, am Grab seiner Mutter. Und später erscheint sie ihm sogar im Schlaf, die Mutter, die sich umgebracht hat, damals, als der Erzähler sie alleingelassen hatte. Das Gefühl der Schuld hat ihn fast erdrückt, ein Leben lang, und nun erscheint sie ihm und sagt: "Du mit deinem ewigen Schuldbewusstsein und deinem Schuldsuchen auch bei anderen. Du bist unschuldig, du dummer Kerl."
Das neue Buch von Peter Handke ist in schönes Dunkelblau gebunden, es heißt "Die morawische Nacht" und handelt von einem Erzähler, der auf sein Hausboot auf dem Fluss Morawa in Serbien die Freunde seines Lebens eingeladen hat, um ihnen eine Geschichte zu erzählen. Es ist die Geschichte eines Rückwegs. Zurück ins eigene Leben, an die Orte, an denen alles begann. Der Erzähler, der uns als Ex-Autor vorgestellt wird, ein Mann, den die europäische Presse vor einer Weile beinahe einstimmig für verrückt erklärt hat, wandert durch Europa und sucht Spuren seiner selbst, Spuren seines früheren Lebens. Die Stadt in Spanien, in der er sein erstes Buch geschrieben hat und wo er die erste Liebe seines Lebens fand. Der Ort im Harz, wo sich seine Eltern einst begegnet sind; der Herkunftsort des Vaters, den er niemals sah; das Grab des Vaters und das Grab der Mutter. Und schließlich sein altes Heimatland, Österreich, das er früh verließ, sein Heimatdorf, das Geburtshaus, den Bruder, den er eine Ewigkeit nicht sah und der ihn zunächst nicht einmal wiedererkennt.
Handke-Leser werden ihren Handke in jeder Zeile wiedererkennen. Es ist ja der alte Handke, die Motive sind aus vielen seiner etwa siebzig bislang veröffentlichten Bücher bekannt; auch seine guten alten Alter Ego Gregor Keuschnigg und Filip Kobal sind wieder da. Trotzdem läuft man gerne wieder mit, all die 560 Seiten lang läuft man mit, und nach einer Weile stellt sich das Handke-Gefühl ein. Dieses Ahnen einer anderen Welt, dieses andere Schauen auf die Dinge, diese Verwunderung zunächst über das Nebeneinander des Wahrscheinlichsten und des Unwahrscheinlichsten. Und das Ausbleiben der Verwunderung nach einer Weile des Lesens.
Ja, auch Jugoslawien kommt wieder vor. Der Kampf darum hatte Handke beinahe mit der ganzen Welt entzweit. Die Wut und der Anklagefuror, die immer wieder auch in seine Prosawerke drängten, hatten seiner Kunst nicht gutgetan. Handke suchte nicht mehr. Handke hatte gefunden. Die Bücher waren enger geworden, härter, schwerer, das Öffnende hatte sich zurückgezogen zugunsten einer klaren Haltung, eines Hasses oft in höchster Not. In Notwehr gegen den Rest der Welt, der sich, wie Peter Handke es sah, hinter einem allzu klaren Serbien-Feindbild verbunkert hatte. Handke verteidigte das Recht auf sein eigenes Bild, seine Wahrheit mit aller Macht und mit allem Furor, der einem Einzelnen zur Verfügung steht.
Es war immer ein sonderbares Nebeneinander von leisester Innenschau, Graswispernlauschen, von Pilzbetrachtung und ewigem Suchen auf der einen Seite und den großen Welt-Behauptungen auf der anderen, den maßlosen Angriffen gegen Kirche, Staaten, Akademien. Im Kampf "Einer gegen alle" glaubte der eine zu immer größeren Worten Zuflucht suchen zu müssen, um die Übermacht zu übertönen.
Im Juni 1977 hat Peter Handke einmal an seinen Lebensfreund, den Schriftsteller Hermann Lenz, geschrieben: "Das Leben fällt mir manchmal schwer und keine Gewohnheit stellt sich ein. Aber irgendeinmal muß man sich doch weggedacht haben können und schön gleichgültig gegen dieses aufdringliche Stück Ich werden. Aber ob man dann vor lauter Haltung nicht erst recht zusammenbricht?"
Das ist der Schriftsteller Peter Handke: das Leben, das Schreiben ohne Gewohnheit, das immer wieder neue Denken, neue Schauen, die Sehnsucht nach dem Sich-Wegdenken, Sehnsucht nach dem Ankommen und zugleich die große Angst davor, weil es dann zu Ende sein könnte mit dem Schreiben für immer.
Das neue Buch erzählt von dieser Angst. Der Erzähler, der seine Freunde auf das Boot geladen hat, um von seinen Reisen zu erzählen, ist, wie gesagt, ein Ex-Autor, einer, der sich frei gemacht hat vom Schreiben, einer, der nicht mehr schreiben will und kann. So reist er dahin, schreibt nichts, legt nichts fest, lässt sich nicht festlegen, sucht und verwirft, und am Ende ist er wieder zum Autor geworden, ganz ohne "Ex-". Wie es dazu kam?
Die Geschichte der morawischen Nacht ist auch die Geschichte eines Abschieds von einem Traum. Von dem Traum Jugoslawien, dem Traum eines großen Vielvölkerstaates, der gleich jenseits der Grenze am Rande des österreichischen Dorfes begann, in dem Peter Handke aufgewachsen ist. Handke hatte sich schon in seinen letzten beiden Prosabüchern behutsam von diesem Traum gelöst, im "Don Juan" in eine Frauenwelt hinein, in dem rasanten Filmbuch "Kali" in eine rasende Jeepfahrt in die Unterwelt. Zu Beginn des neuen Buches sind wir mit dem Erzähler noch einmal in einer serbischen Enklave im Kosovo. Traurig, ruhig und mitleidsvoll beschreibt Handke das Unglück der Bewohner, die in einer Busfahrt durch das sie umgebende feindliche Land, unaufhörlich mit Steinen beworfen, zu dem Friedhof ihrer Ahnen fahren, den es nicht mehr gibt. Die Gräber wurden zerstört, aber sie sitzen da und denken zurück und weinen gemeinsam. Der Erzähler zieht sich zurück. Die Wut, seine Wut, leiht er dem Busfahrer, der die Trauernden durch den Steinhagel fuhr und der ins Land hinausruft: "Euer Haß auf jeden, der nicht eurer Staatsangehöriger ist, auf alles, was nicht Staat ist! Keinen Stolz bezieht ihr aus eurem Staat, sondern die Legitimierung und Verewigung eures Hassens."
Der Ex-Autor verabschiedet sich von diesem Hass, von diesem Balkan, von dieser Gegenwart: "Weg wünschte er sich von diesem finsteren Balkan in die Lichterkettenmetropolen mit den sonor hupenden Taxis zwischen den Wolkenkratzerschluchten, mit den Brücken, auf denen jedes Liebespaar etwas wie ein Friedensgruß war." Weg also von hier, hinüber in die Welt, wie sie früher war oder wie sie einmal sein könnte. Eine Vorstellungswelt aus der Vergangenheit. Oder einer Zukunft.
So wandert er umher. Nimmt teil an einem Kongress der Lärmgeschädigten, die zu jedem Gewaltakt gegen den allgegenwärtigen Krach der Welt und dessen Verursacher bereit sind. Ist Zuschauer und Zuhörer bei einem Treffen der Maultrommelspieler dieser Welt, die am Ende in ein schrilles Aufspielen der Nationalhymnen ihrer Herkunftsländer verfallen. Es ist ein Schrecken, den er flieht, der Ex-Autor. Doch der größte Schrecken ist die Frau, die eine Frau, die ihn liebt, die ihn verfolgt.
"Zur Hölle mit ihr", heißt es schon zu Beginn. Und "Zur Hölle mit dir" dann ganz zum Schluss. Bevor er zuschlägt. Zunächst noch "ein Lächeln von ihr, im Glauben, er rede im Spiel und seine Sätze meinten eher das Gegenteil. Aber schon hatte er sich auf sie gestürzt und auf sie eingeschlagen, einmal bloß, bloß? so stark, daß sie stracks zu Boden fiel".
Er war die ganze Zeit vorbeigezogen an lauter Monstern auf seiner Wanderung, an Schreckensboten und Schreibbedrohern. Doch hier, kurz vor dem Schluss, "entpuppt sich als nächstes Monstrum in der Geschichte der Erzähler selbst". Ja, ein Monstrum, das zuschlägt, wenn es eingeengt wird von einer anderen Macht. Ein brutaler Schläger, der sich seine Freiheit erkämpft. Ja, ein Monstrum, aber eines, das monströs handeln musste, wie er sich selbst bescheinigt: "Er hatte recht gehandelt. Triumph!", ruft er sich am Ende zu.
Als Leser ist man da nicht ganz so schnell mit dem Freispruch bei der Hand. Die Gewalt des Erzählers bleibt als Schock zurück. Ein Autor kämpft sich frei, mit aller Macht. Von allen Zwängen frei, frei von Schuld, frei von allem, um wieder zum Schreiben zu finden. Und zum Sehen, jenseits des Zeitungssehens: "Am nächsten Morgen, was stand da in der Zeitung? Nichts, und wieder nichts. Tags darauf stieg jemand auf eine Leiter aus Strohhalmen, und sie hielt, und am Abend desselben Tages drückte jemand auf eine Klinke, und die Tür ging auf. Ein paar Tage später spielte jemand auf einer Maultrommel ,Der Tod und das Mädchen' und jemand schüttelte beim Weinen den Kopf."
Am Ende ist nichts mehr da. Er kehrt zurück, doch das Boot ist fort. Die Enklave ist fort. Die Morawa ist versiegt, und auch die Freunde gibt es nicht mehr oder hat es nie gegeben. Er schreibt ein Buch, schreibt es wie früher in der Nacht: "Nicht wenige solcher nächtlichen Bücher hatte der Autor im Lauf seines Lebens verfaßt, die vom Tageslicht in nichts aufgelöst worden waren. In nichts? Wirklich?"
Ja - fast nichts. Keine Botschaft, keine Nachricht, nur Schönheit als Ahnung und Lesen als Glück. Fast nichts - und mehr denn je.
VOLKER WEIDERMANN
Peter Handke: "Die morawische Nacht". Suhrkamp 2008. 560 Seiten, 28 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main