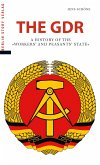Woran die DDR gescheitert ist - das stalinistische Trauma der Gründergeneration: Die DDR war geprägt von Paranoia und Denunziation. Der Historiker und Publizist Andreas Petersen erzählt, wie es dazu kam, und erkundet das Trauma der Gründergeneration um Pieck und Ulbricht.
Sie hatten in Moskau die Jahre des Terrors erlebt, in denen Stalin mehr Spitzenkader der KPD ermorden ließ als Hitler. Angst und Verrat wurden für die Exilanten aus Deutschland zur schrecklichen Normalität.
Ab 1945 übernahmen die zurückgekehrten »Moskauer« die Führung in der sowjetisch besetzten Zone. Die ersten Jahre waren Stalin-Jahre, Zweifel und Fragen waren in der neu gegründeten SED nicht erwünscht. Die »Moskauer« hätten sich sonst der eigenen Verstrickung stellen müssen. Denn jeder von ihnen hatte jemanden denunziert, um sich selbst zu retten, und jeder wusste es vom Anderen. Ein Mantel des Schweigens legte sich über den neuen Staat.
Fesselnd schildert Andreas Petersen dieses Gründungstrauma und seine Folgen - ein lebendiges Psychogramm der führenden SED-Funktionäre, aber auch der Gesellschaft der DDR. Bis heute wird geschwiegen, Verwundungen, Ängste und Zorn sind nicht verschwunden. Ein aufrüttelndes Buch, das dazu beitragen kann, die noch immer spürbare Zerrissenheit zu überwinden.
Sie hatten in Moskau die Jahre des Terrors erlebt, in denen Stalin mehr Spitzenkader der KPD ermorden ließ als Hitler. Angst und Verrat wurden für die Exilanten aus Deutschland zur schrecklichen Normalität.
Ab 1945 übernahmen die zurückgekehrten »Moskauer« die Führung in der sowjetisch besetzten Zone. Die ersten Jahre waren Stalin-Jahre, Zweifel und Fragen waren in der neu gegründeten SED nicht erwünscht. Die »Moskauer« hätten sich sonst der eigenen Verstrickung stellen müssen. Denn jeder von ihnen hatte jemanden denunziert, um sich selbst zu retten, und jeder wusste es vom Anderen. Ein Mantel des Schweigens legte sich über den neuen Staat.
Fesselnd schildert Andreas Petersen dieses Gründungstrauma und seine Folgen - ein lebendiges Psychogramm der führenden SED-Funktionäre, aber auch der Gesellschaft der DDR. Bis heute wird geschwiegen, Verwundungen, Ängste und Zorn sind nicht verschwunden. Ein aufrüttelndes Buch, das dazu beitragen kann, die noch immer spürbare Zerrissenheit zu überwinden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Fabian Wolff nimmt es mit Humor und sieht in Andreas Petersens Studie "Die Moskauer" einen Beitrag zur Debatte um DDR-Trauma und Migrationshintergrund. Der Historiker Petersen beleuchtet in seinem Psychogramm der alten KPD-Führung, wie Ulbricht, Pieck und Co. von ihren Exil-Erfahrungen in Stalins Moskau geprägt wurden und wie sie damit der DDR den Stempel aufdrückten: Denunzieren oder denunziert werden. Wie Petersen die Atmosphäre der Angst und des Terrors in Moskau schildert, lässt Fabian gelten, zumal Petersen viele bekannte Quellen nutzt. Den von der Totalitarismustheorie geprägten Deutungen des Autors kann der Kritiker allerdings nichts abgewinnen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Gründerväter der DDR - von gegenseitigem Misstrauen und Sprachlosigkeit geprägt
"Es ist doch ganz klar: Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben." Diese Sätze stehen in den Erinnerungen von Wolfgang Leonhard. Walter Ulbricht soll sie am 1. Mai 1945 in Berlin gesagt haben, kurz nachdem ein sowjetisches Flugzeug ihn und seine Gefährten aus Moskau nach Deutschland zurückgebracht hatte. Manch einer mag noch gehofft haben, nach der zwölfjährigen Schreckenszeit könnten sich in Deutschland neue Wege in den Sozialismus eröffnen, die sich von der sowjetischen Diktatur unterschieden. Die "Moskauer" aber schufen Tatsachen. Sie setzten ihren autoritären, stalinistischen Stil gegen alle Widerstände durch. Und am Ende kam es so, wie Ulbricht es vorausgesagt hatte. Andreas Petersen spricht vom "Stalintrauma" als dem Gründungsakt der DDR. Ulbricht und seine Genossen, die in den dreißiger Jahren in die Sowjetunion emigrierten, seien durch Terror, Furcht und Schrecken sozialisiert worden, und diese Erfahrungen seien für die Einrichtung der Macht in der DDR entscheidend gewesen.
Natürlich weiß auch Petersen, dass die KPD eine autoritäre und hierarchisch strukturierte Partei war, noch bevor ihre leitenden Funktionäre nach 1933 in die Sowjetunion flüchteten. Ihre eigentliche Feuertaufe aber hätten Ulbricht, Pieck und andere erst im Heimatland der Revolution erhalten. Abgeschnitten und isoliert, waren die deutschen Kommunisten ihren Gastgebern ausgeliefert. Kaum einer sprach Russisch oder verstand, worauf es die Hetzjagd auf vermeintliche Saboteure und Spione abgesehen hatte. Nacht für Nacht wurden im Hotel "Lux", in dem die deutschen Funktionäre wohnten, Menschen aus ihren Zimmern geholt und in die Lubjanka gebracht. Sie wurden erschossen oder in Zwangsarbeitslager verschleppt, ohne dass die Angehörigen je erfuhren, was man ihnen zur Last legte.
Aber welche Wahl hatten Emigranten schon, die nirgendwo hingehen konnten? In wenigen Wochen lernten sie, worauf es im Überlebenskampf ankam. Schon bald kam ihnen die Lüge automatisch von den Lippen, Verstellung und Misstrauen wurden ihnen zur zweiten Natur. Wer die Schule der Paranoia absolviert hatte, war bereit, alles für möglich zu halten. Danach, so Petersen, habe kein Kommunist es mehr gewagt, Widerworte zu geben. Selbst die absurdesten Verschwörungstheorien habe man nun für glaubhaft halten müssen. Nach dem ersten Moskauer Schauprozess gegen prominente Bolschewiki lieferte die Kaderabteilung der KPD dem NKWD Informationen über Verräter und Spione in den eigenen Reihen. In der deutschen Parteipresse erschienen hysterische Aufrufe: Der "menschliche Abschaum" müsse ausgerottet und "alle noch vorhandenen Überreste des Gesindels unschädlich" gemacht werden. Der Gulag und die Lubjanka waren Orte irdischer Verdammnis, eine moderne Variante der Disziplinierung durch Furcht. Seht her, wohin ihr kommen werdet, wenn ihr nicht gehorcht! Alle deutschen Kommunisten, die das Jahr 1937 überlebt hatten, verinnerlichten diese eine Lehre: Liebe den Gehorsam und die Lüge, denn sie retten dir das Leben. Die Partei und ihre Generallinie wurden zum Über-Ich, zur einzigen Erklärungsressource, aus dem sich noch Sinn schöpfen ließ. Hugo Eberlein, der gefoltert worden und ohne Verhandlung zu 15 Jahren Haft verurteilt worden war, schrieb in einem Brief an Wilhelm Pieck, dass die "Partei Lenins" diese "schreckliche Ungerechtigkeit" nicht zulassen werde. Er konnte und wollte sich Stalin nicht als Urheber all dieser Verbrechen vorstellen. Eberlein wurde 1941 erschossen, Pieck verlor kein Wort mehr über ihn.
Die seelischen Wirkungen waren verheerend. Es gab irgendwann kein Gemeinschaftsleben mehr, Gespräche verstummten. "Die deutsche Emigration hier ist völlig atomisiert", schrieb der Kommunist Franz Schwarzmüller an Stalin. "Jeder lebt für sich in seinen vier Wänden, aus Furcht vor Verhaftungen in seinem Bekanntenkreis oder sonstwo ebenfalls hineingezogen oder zumindest diskreditiert zu werden." Die Emigrantengemeinde richtete sich in einer Atmosphäre des Misstrauens und der Sprachlosigkeit ein. Aber in ihr entstand auch der stalinistische Funktionär, der Meinungen aufgab und Freunde opferte, wenn es von ihm verlangt wurde. Man pries die Mörder der eigenen Kinder und besang den Diktator, der für die Mordexzesse verantwortlich war. Walter Ulbricht war ein Mann von geringem Verstand. Aber er war ein höriger Vasall Stalins. In Moskau lernte er, wie man Konkurrenten ausschaltete und welche Mittel im Überlebenskampf von Nutzen waren. Petersen schreibt: "Diese Lektion nahm Ulbricht vollständig in sich auf. Seine Härte, sein Dogmatismus und seine Gefühlskälte verfestigten sich in den Moskauer Jahren zu jenem Funktionärstypus, den Stalin zur Terrorherrschaft brauchte."
Als der Krieg zu Ende ging, gab es für Stalin überhaupt keinen Zweifel, dass die "Moskauer" den neuen Staat auf deutschem Boden errichten sollten. Kommunisten, die im Untergrund, im westlichen Ausland oder in den Lagern der Nationalsozialisten gewesen waren, konnte Stalin nicht gebrauchen. Ulbricht und seine Genossen hingegen waren bereit, jeden Befehl auszuführen. Was die Moskauer selbst erlitten hatten, gaben sie nun an die Deutschen weiter, die sich ihrer Herrschaft beugen mussten. Zehntausende verschwanden in den Lagern der sowjetischen Besatzungsmacht, wurden erschossen oder in die Sowjetunion deportiert. Auch in der DDR wurde die Sprache des Terrors gesprochen. Man solle "Schädlinge" ausrotten und "Schumacher-Agenten" entlarven, so lauteten die Parolen, die in der Partei neuen Typs aufgesagt werden mussten. Auch in der DDR wurden Schauprozesse nach sowjetischem Muster vorbereitet, Spanien-Kämpfer, Juden und Westemigranten als Spione und Agenten des amerikanischen Imperialismus diskreditiert. Im Stahlbad des Terrors verwandelte sich die SED in eine stalinistische Kaderpartei. Petersen spricht vom "Purgatorium", das den stalinistischen Funktionär hervorbrachte.
Für all jene, die das Jahr 1937 in der Sowjetunion erlebt hatten, sei die Wiederkehr der Gewalt aber auch ein Akt der Retraumatisierung gewesen. Niemand konnte und wollte über die erlittene Gewalt sprechen, was geschehen war, musste verschwiegen oder umgeschrieben werden. Die Partei war der einzige Lebensraum, der den Davongekommenen geblieben war. Nie verließ sie die Angst, aber im Angesicht der Wahrheit, die man über diese Erfahrungen hätte aussprechen können, wäre das System zusammengebrochen. Hätte man sich nach all den Entbehrungen eingestehen sollen, einer falschen Sache gedient zu haben? Wer hätte über die Ohnmacht und die Demütigungen, die einem zugefügt worden waren, überhaupt sprechen können? Das Weltvertrauen war zerstört und mit ihm die Möglichkeit, anderen zu vertrauen. Am Ende siegte das Gefühl der Dankbarkeit über das Bedürfnis, das Unausgesprochene zur Sprache zu bringen. Man war noch einmal davongekommen, und man hatte diese Gnade nur dem Großmut der Partei zu verdanken. Immerhin konnte man anderen antun, was einem selbst angetan worden war. Und nach allem, was die "Moskauer" erlebt und erlitten hatten, konnten sie die Gewalt als reinigendes Gewitter rechtfertigen, als Purgatorium, das Sünder in Erlöste verwandelte. Andreas Petersen hat ein wichtiges, notwendiges Buch geschrieben. Es ist dem Leben auf der Spur, das sich hinter den Erzählungen vom Leben verbirgt. Über die DDR und ihre Gründungsväter wird man nach der Lektüre dieses klugen Buches wahrscheinlich anders sprechen müssen als bisher.
JÖRG BABEROWSKI
Andreas Petersen: Die Moskauer. Wie das Stalintrauma die DDR prägte.
S. Fischer Verlag, Frankfurt/ Main 2019. 384 S., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Insgesamt liegt ein informatives und lesenswertes Werk vor, das insbesondere in den biographischen Abschnitten und zur "Kultur des Vergessens" reichhaltige Beiträge leistet. Werner Müller Jahrbuch "Extremismus & Demokratie" 20210125