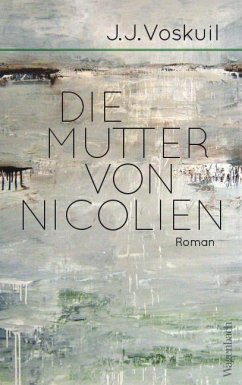Nicoliens Mutter vergisst. Erst vertauscht sie die Tage, dann kann sie ihre Lieblingslieder nicht mehr mitsingen, zuletzt verirrt sie sich in der Wohnung. Über knapp drei Jahrzehnte wird ihre Demenz in vielerlei Alltags- und Ausflugsszenen mit den schleichenden Veränderungen beschrieben. Alsbald wähnt man sich im Wohnzimmer der Familie, mit Schnaps in der Hand und Kuchen auf dem Tisch, erfüllt von Zuneigung und Hilflosigkeit. Wie in einem Super-8-Film werden der Gedächtnisverlust und die Reaktionen der Angehörigen, die zwischen Verärgerung, Irritation, Trauer und Ungeduld schwanken, in einer Fülle von lebendigen Details nachgesponnen. In genau abgelauschten Dialogen und auf musikalische Weise, in Varianten, Schleifen, Pausen erzählt J. J. Voskuil die Geschichte einer Frau, die zunehmend unerreichbar wird. Eine zutiefst menschliche Chronik - von Gerd Busse einmal mehr herausragend übersetzt.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Wolfgang Schneider liest das Spin-off von J. J. Voskuils Romanzyklus "Das Büro" mit Beklemmung. Die Geschichte der Ehefrau des Romanhelden Maarten, genauer ihrer dementen Mutter, erzählt Voskuil laut Schneider als Abfolge der unausweichlichen Stadien der Erkrankung. Unheimlich wirkt das auf Schneider auch deshalb, weil der Autor nichts erklärt, sondern nur genau dokumentiert. Spannung entsteht dennoch, so Schneider, da der Leser auf die jeweils nächste Krankheitsstufe wartet. Ein Schrecken mit Ansage für den Rezensenten. Gerd Busses Übersetzung folgt der Lakonie des Originals, lobt Schneider.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Neben seinem Büro-Zyklus hat er noch mehr zu bieten: J. J. Voskuils "Die Mutter von Nicolien"
Es war eine der merkwürdigsten literarischen Sensationen, seit es Bestsellerlisten gibt. In den Niederlanden waren die Leser vor zwanzig Jahren den sieben Bänden von J. J. Voskuils Romanzyklus "Das Büro" so verfallen wie der Rest der Welt der Magie Harry Potters. Dabei wird die Handlung bei Voskuil nicht durch Zauberkräfte angetrieben, sondern entschleunigt durch den auf fünftausend Seiten protokollierten Alltag im Amsterdamer Büro eines ethnologischen Instituts. Wichtel gibt es dort allerdings auch, aber nur als Gegenstand eines langwierigen Forschungsprojekts über niederländische Volksmythologien.
Ein Spin-off des "Büros" ist der erst jetzt in deutscher Übersetzung erschienene Roman "Die Mutter von Nicolien". Bei Nicolien handelt es sich um die Ehefrau der "Büro"-Hauptfigur Maarten. Wieder hadert sie mit der erschöpfenden Arbeit ihres Mannes, deren Sinn sie offenbar nicht erkennen kann. Ungern sieht sie Karteikarten und Fachbücher in seiner Hand. Und kann es nicht leiden, wenn er Rezensionen schreibt: "Eine Besprechung? Für das Büro? In deiner Freizeit! Ich höre ja wohl nicht recht!"
Der Fokus dieses eigenständigen Bandes richtet sich allerdings auf Maartens Schwiegermutter, eine freundliche, unauffällige Frau mit einem Heißhunger auf Kuchen, den sie am liebsten gemeinsam mit Tochter und Schwiegersohn spachtelt. Und wenn dazu noch ein Gläschen Eierlikör gereicht wird, ist schon ein Höhepunkt der Handlung erreicht. Wäre da nicht noch etwas anderes, Unheimliches, das sich allmählich in den unspektakulären Alltag einschleicht. Etwa wenn die Mutter lange in ihrer Handtasche herumwühlt, um endlich ratlos zu fragen: "Was suche ich bloß?"
Demenz ist in den letzten Jahren zu einem großen Thema der Literatur geworden. Autoren berichten in autobiographischen Texten vom Niedergang ihrer Väter oder Mütter. Arno Geigers Buch "Der alte König in seinem Exil" hat viele Leser angerührt. Und Burkhard Spinnen hat mit "Die letzte Fassade" ein sehr ehrliches Buch über die Demenz seiner Mutter geschrieben, das ganz ohne Poetisierung oder literarische Überhöhung der Krankheit auskommt und auch die Überforderung der Angehörigen thematisiert. Um nur zwei gegensätzliche deutschsprachige Werke zu nennen.
Voskuils Roman ist gerade deshalb interessant, weil er auf alles Erklärende verzichtet und mit protokollierender Genauigkeit den Verlauf der Krankheit beschreibt. Statt Kapitelüberschriften gibt es schlichte Datumsanzeigen, die von 1957 bis zur Beerdigung der Schwiegermutter im Jahr 1985 reichen. Offenbar hat Voskuil ein Demenz-Tagebuch geführt, das die Grundlage dieser literarischen Langzeitstudie bildet. Die Krankheit ist unheilbar, ihr Verlauf vorhersehbar. Aber auch wenn das Erzählen deshalb eigentlich völlig überraschungsfrei ist - es gibt eine Spannung der anderen Art. Wie bei der Eskalation eines Dramas wartet man auf das gesetzmäßige Erscheinen der Symptome der jeweils nächsten Krankheitsstufe.
Die Mutter von Nicolien findet Dinge nicht mehr, verläuft sich, verwechselt die Seife mit einem Stück Käse oder Maartens Schuh mit einem Hündchen. Schließlich erkennt sie ihre Tochter nicht mehr. Zunächst und vor allem aber hinterlässt die Krankheit ihre Spuren im Gespräch und zwingt diesem zunehmend die Struktur der Wiederholung auf. Immer wieder wird die gleiche Frage gestellt, immer wieder wird sie von den Angehörigen (meist freundlich, mal ein bisschen genervt) beantwortet. Das Sprechen bekommt etwas von einem befremdlichen Ritual. Von solchen Dialogen als Spiegel der schrumpfenden Welt im Kopf ist Voskuils Roman über weite Strecken geprägt. Noch mehr als in David Wagners Vater-Roman "Der vergessliche Riese" bestimmt hier die Krankheit die Erzählform. Gerd Busses Übersetzung gibt Voskuils lakonische Präzision sehr gut wieder; allerdings klingt es irritierend, wenn die Tochter die eigene Mutter siezt. Es ist eine niederländische Respektsform, für die es im Deutschen keine Entsprechung gibt, und vielleicht sollte eine Übersetzung deshalb auf solch fehlgehende Wörtlichkeit verzichten.
Immer wieder kommen die Dialoge mit der Mutter an jenen Punkt, an dem sich die unheimlichste Frage in Zusammenhang mit der Demenz stellt: Da die Krankheit den Wahrnehmungsapparat selbst betrifft, ist unklar, in welchem Maß die Betroffenen ihr eigenes Elend mitbekommen. Würden sie bemerken, dass sie ständig Fragen wiederholen, würden sie es nicht tun. Aber warum versuchen sie, wie es die Mutter von Nicolien regelmäßig tut, die Aussetzer in Gedächtnis und Sprache zu bagatellisieren und zu überspielen, oft sogar mit erstaunlicher Schlagfertigkeit? Sie verhalten sich so, als hätten sie einen furchtbaren Verdacht. Sehr kennzeichnend auch, dass die Mutter bei anderer Gelegenheit, wenn sie sich einmal gut an etwas erinnert, sofort erfreut in die Offensive geht: "Du hast wohl gedacht, dass ich es vergessen hätte, aber ich bin ja noch nicht völlig senil."
Am Ende der traurigen Verfallskurve ist der Körper (wie eingeschränkt und versehrt auch immer) noch da, aber das Ich in ihm ist verwelkt. Nach dem unvermeidbaren Umzug der Mutter ins Pflegeheim halten Tochter und Schwiegersohn ihre Hand und hoffen, dass da noch ein Seelenrest ist, der es spürt. Die traurige Wahrheit aber teilt der Roman mit der größten Lakonie mit - in Form der Daten. Die Mutter oder das, was von ihr übrig ist, wird in den letzten Jahren immer seltener und schließlich nur noch am Geburtstag besucht. Am Ende dieses Romans, als Gespräche nicht mehr möglich sind, schildert Voskuil Maartens Eindrücke im Pflegeheim. Die Alten sitzen, jeder eine versunkene Welt für sich, vornübergesackt in ihren Rollstühlen, versuchen ein Glas zu heben, werden mit verschmierten Gesichtern gefüttert und stoßen unverständliche Laute aus. Maarten fühlt sich immer beklommener: "So stellte er sich das Jenseits vor."
"Es hätte etwas Anrührendes gehabt, wenn es nicht so traurig gewesen wäre" - diese Formulierung lässt sich auf viele Szenen des Romans beziehen, etwa wenn die Mutter zum letzten Mal ihr Haus verlässt. "Pflegeheim Sammersbrug", sagt Maarten leise zum Taxifahrer. Und die Mutter scheint zu spüren, dass es kein Zurück gibt: "Tschüss Häuschen, sagte sie leise." WOLFGANG SCHNEIDER
J. J. Voskuil: "Die Mutter von Nicolien". Roman.
Aus dem Niederländischen von Gerd Busse. Wagenbach Verlag,
Berlin 2021. 256 S., geb., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main