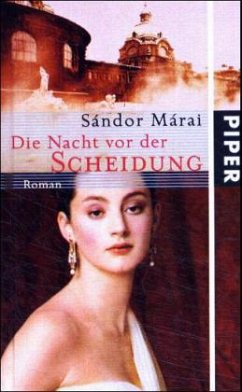Obsession und existentielle Einsamkeit, emotionale Nähe und der Zerfall einer Lebensordnung – unter der Vorahnung des Zweiten Weltkriegs verbinden sich die Schicksale dreier Menschen auf tragische Weise.
»Die Verhandlung kann nicht stattfinden, weil ich heute meine Frau getötet habe. Und ich bin gekommen, weil ich dir alles erzählen will.« Mit dieser verzweifelten Eröffnung beginnt das nächtliche Gespräch zwischen dem Richter und seinem späten Gast. – Erschöpft ist Christoph Kömüves mit seiner Frau von einer Gesellschaft heimgekehrt. Und als sei die tiefe Unruhe, die an diesem Abend auf ihm lastet, nur eine unerklärliche Vorahnung, erhält er überraschend Besuch von einem Gefährten aus Jugendzeiten: Imre Greiner, dessen Ehe mit der schönen, verwöhnten Anna Fazebas er am folgenden Morgen würde lösen müssen, bittet ihn zu sprechen. Kömüves ist dem Freund seit Jahren nicht mehr begegnet. Doch der angesehene Arzt kommt ohne Umschweife zur Sache, und er sucht Antwort auf eine Frage, die nur der Richter ihm geben kann.
»Die Verhandlung kann nicht stattfinden, weil ich heute meine Frau getötet habe. Und ich bin gekommen, weil ich dir alles erzählen will.« Mit dieser verzweifelten Eröffnung beginnt das nächtliche Gespräch zwischen dem Richter und seinem späten Gast. – Erschöpft ist Christoph Kömüves mit seiner Frau von einer Gesellschaft heimgekehrt. Und als sei die tiefe Unruhe, die an diesem Abend auf ihm lastet, nur eine unerklärliche Vorahnung, erhält er überraschend Besuch von einem Gefährten aus Jugendzeiten: Imre Greiner, dessen Ehe mit der schönen, verwöhnten Anna Fazebas er am folgenden Morgen würde lösen müssen, bittet ihn zu sprechen. Kömüves ist dem Freund seit Jahren nicht mehr begegnet. Doch der angesehene Arzt kommt ohne Umschweife zur Sache, und er sucht Antwort auf eine Frage, die nur der Richter ihm geben kann.

Kalte Glut: Sándor Márai beschwört "Die Nacht vor der Scheidung"
Vielleicht gehört die triumphale Wiederentdeckung Sándor Márais ja zu den Symptomen der deutschen Krise. Keiner schreibt so bittersüße, traurig-schöne Schicksals- und Liebesromane aus einer Welt, die in halt- und kraftloser Melancholie ihrem Untergang entgegendämmert. An Freud geschult, verschränkt Márai dabei geschickt Gesellschafts- mit Psychoanalyse, "die dunklen Begierden der Unterwelt" mit der taghellen, vivisezierenden Vernunft des gebildeten Subjekts. Das ferne Wetterleuchten von Revolution und Krieg setzt sich bei ihm umstandslos in seelische Erschütterungen, das nahende Erdbeben in den "Schwindel" des Herzens um: Jedes gebrochene Frauenherz, jede zerbrochene Männerfreundschaft, jede gescheiterte Ehe ist der Spezialfall einer umfassenderen, kollektiven Krise. Am Himmel dräut der Untergang des Bürgertums, unter der Erde grollt das anthropologische Unbehagen in der abendländischen Kultur: Unter der dünnen Kruste der Zivilisation brodeln verdrängte Triebe, die das Form und Halt gebende Gehäuse von Gesetz, Bildung und Etikette und mit ihm alle Sicherheiten von Beruf, Ehe und Familie untergraben. Die Frauen, in den Abgründen der Seele zu Hause, zerbrechen oft daran, und die Männer, die würdevoll und müde ihre Pflicht erfüllen, werden zu Schauspielern, Hochstaplern und manchmal auch zu Mördern.
"Die Nacht vor der Scheidung" von 1935 ist so etwas wie das Vorspiel zu dem sieben Jahre später erschienenen Roman "Die Glut". Dort trafen sich zwei Jugendfreunde nach über vierzig Jahren wieder, um sich in einer nächtlichen Herrenrunde über eine gemeinsame Liebe auszusprechen, die ihr Leben schicksalhaft veränderte. Hier begegnen sich zwei Mitglieder des gehobenen Mittelstands - der physisch und psychisch schon leicht "verfettete", aber durch und durch ehrbare Richter Christoph Kömüves und sein Jugendfreund, der Arzt Imre Greiner - nach zehn Jahren unter ungünstigen Vorzeichen wieder: Am nächsten Morgen soll Kömüves Greiners Ehe scheiden. Der Richter wird sein Urteil nicht mehr sprechen, sondern noch in dieser Nacht Gerichts-Tag über sein eigenes Leben halten müssen. Greiner gesteht ihm, soeben seine geliebte Frau Anna getötet zu haben, und will, ehe die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt, nur noch eines wissen: "Hast du in all diesen Jahren von Anna geträumt?"
Die Frage zielt ins Herz Kömüves', ins Zentrum lang verdrängter Wahrheiten. Tatsächlich hätte Anna die Liebe seines Lebens werden können, wenn er damals, bei einer flüchtigen Begegnung, statt konventioneller Floskeln das richtige Wort gefunden hätte, seinen Charakterpanzer aus Korrektheit, Pflicht- und Verantwortungsgefühl für einen Moment gelockert hätte. Kömüves hat damals versagt und auch später seine Träume verleugnet; jetzt zwingt ihn das Drama Greiners zur existentiellen Selbstprüfung. Wovon der Arzt hilflos stammelt, ist auch seine Tragödie. "All dies sogenannte Glück ist unvollkommen": Sein edles Berufsethos war eine Lüge, seine perfekte Ehe das Nebeneinanderleben zweier Fremder. "Wohin soll ich mich flüchten? In das ,Leben'? Was ist das? Irgendeine Art Theater mit aufgedonnerten Frauen, Trompetenlärm und dressierten Seehunden? Soll ich mich in die Arbeit flüchten? Aber alles hat doch nur einen Sinn, wenn Anna dahintersteht." Wie Anna sich Greiner im Freitod entzog, entzieht sich Hertha ihrem Mann im Leben: Der Arzt konnte und wollte seiner Frau nicht mehr helfen, der Richter klagt sich selber an.
Für Kömüves ist das Leben eine "lästige und komplizierte Pflicht", das Geheimnis der Liebe eine bedrohliche, "regelwidrige" Störung im gesetzlichen Betrieb. So dient er unter Selbstaufopferung der Welt: Die Elite darf nicht erschlaffen, muß ihre Zweifel und "Nervosität" bannen, um die Zivilisation zu retten. Als Vertreter göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit muß der letzte Sproß einer alten Juristendynastie die dunklen Seiten des Lebens demütig und streng ausblenden, gerade weil er ahnt, daß "zwischen Einschlafen und Erwachen ein unbekannter Wille wirkt". Für Márai ist sein Versagen Ausdruck einer sozialen "Frigidität", ein Trauma, das tiefenpsychologisch motiviert und seziert, aber letztlich auf historische Ursachen zurückgeführt wird: Das nervöse Subjekt der Moderne hat sein transzendentales Obdach, der Bürger seinen festen Halt an Tradition, Stand und Staat verloren.
So schreibt Márai wie ein gelehriger Schüler seines Landsmanns Georg Lukács: vom Allgemeinen zum Konkreten, vom Gesellschaftlichen zum Individuellen, von der Krankheit der Zeit zu ihren Symptomen herabsteigend. Darin liegt auch die Schwäche seines Romans. Die ganze erste Hälfte ist Exposition, ebenso handlungsarme wie gedankenreiche Entfaltung der "objektiven" Bedingungen. Distanziert und leidenschaftslos, manchmal auch etwas steif und immer akkurat geordnet, beschreibt Márai Herkunft, Elternhaus, Erziehung seines Helden, seine überholten Auffassungen von Politik, Recht, Religion, Ehe und Familie, auch seine Zweifel, Ängste und seine stille Resignation. Nicht nur der Richter, der mit "demütiger Bereitwilligkeit" den Regeln und Gesetzen seiner Klasse gehorcht, hat eine antiquierte Lebensphilosophie: Auch das erzählerische Konzept Márais ist angestaubt. Seine Romane gehören doch wohl eher in die Klasse eines Stefan Zweig oder Otto Flake als in die Champions League von Schnitzler und Musil.
Mit dem Gespräch der Männer kommt etwas Bewegung in die schwüle, stickige Luft. Aber die Geschichte, die Greiner erzählt, ist nur eine konventionelle Ehetragödie, und beim melodramatischen Schluß greift der sonst so leise Erzähler dann zum "mechanischen Lautsprecher der Seele" und zur gehobenen Kolportage. So glänzend Márais Kammerspiel die Welt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs erfaßt, so eindringlich er Fragen von Pflicht und Neigung, Tag und Nacht, Schuld und Sühne verhandelt: Seine Analyse erscheint, bei aller Hellsichtigkeit, mechanisch und vorhersehbar, seine Psychologie der Nervosität seelenruhig behäbig, sein virtuoser Stil epigonal. Am Ende bleiben dem Richter wie seinem Erzähler nur heroisches Ausharren und Dienst nach Vorschrift in den leeren Fassaden der bürgerlichen Romankonvention.
MARTIN HALTER
Sándor Márai: "Die Nacht vor der Scheidung". Roman. Aus dem Ungarischen übersetzt von Margit Ban. Piper Verlag, München 2004. 220 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Ursula Pia Jauchs Urteil über diesen Roman des ungarischen Autors Sándor Márai, der bereits 1935 in Ungarn erschien und nun auch in deutscher Übersetzung vorliegt, ist zwiespältig. Erzählt wird von einem Richter, auf dessen Schreibtisch der Scheidungsfall eines Schulfreundes landet, dessen Frau er vor seiner eigenen Hochzeit einmal gekannt und vielleicht geliebt hat, teilt die Rezensentin mit. Zunächst ist sie äußerst angetan von der dichten Schilderung der Figur des ehrgeizigen Richters Christoph Kömüves, der sein Leben zwar tugendhaft aber gleichzeitig als lästige Pflichterfüllung erlebt. Der Autor entwickelt hier ein "düsteres Stimmungsbild" sowohl eines individuellen Schicksals wie auch einer ganzen Gesellschaft kurz vor dem Krieg, und in "solchen literarischen Bittermandeln" liegt für Jauch auch die "grosse Kunst" Márais. Wenn am Ende aber ans Licht kommt, dass die Frau des Schulfreundes sich vergiftet hat und zudem während ihrer gesamten Ehe an ihrer unglücklichen Liebe zum Richter litt, wird, was der Rezensentin bis dahin als "große Literatur" schien, zu ihrer großen Enttäuschung zum Heftchenroman nach Art der "Courths-Maler-Schule". Nach Ansicht von Jauch verliert der Roman an dieser Stelle "seinen Halt" und driftet in die "gänzlich konventionelle Psychologie einer überzuckerten Liebesgeschichte" ab.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH