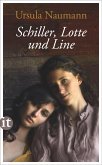Die Literatur der Welt ist in Bewegung: Als Ergebnis der Entkolonialisierung der 60er- und der Globalisierung der letzten 30 Jahre ist eine völlig neue, nicht-westliche Literatur entstanden, die zumeist von Migranten und Sprachwechslern aus ehemaligen Kolonien und Krisenregionen geschrieben wird. Nomadische Autoren erzählen farbig und prall, reflektiert und in den unterschiedlichsten Tönen Geschichten über gemischte Herkünfte und hybride Identitäten, transnationale Wanderungen und schwierige Integrationen. Sigrid Löffler stellt ihre wichtigsten Repräsentanten vor, ordnet ihre Werke bestechend und klug in die großen politisch-kulturellen Konfliktfelder der Gegenwart ein, von V.S. Naipaul, Salman Rushdie, Michael Ondaatje und J.M. Coetzee bis zu Aleksandar Hemon, Teju Cole und Gary Shteyngart.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Globalisierung und Migration haben nicht nur die Welt, sondern auch die Weltliteratur verändert. Sigrid Löffler wagt eine Bestandsaufnahme.
Von Hubert Spiegel
Niemand konnte ahnen, was die Ankunft dieses Schiffes für die Zukunft der Literatur bedeuten würde. Als die "Empire Windrush" am 22. Juni 1948 in England anlegte, hatte sie nicht nur 493 Passagiere aus Jamaika an Bord, die sich als die ersten westindischen Immigranten auf der Suche nach Arbeit und bescheidenem Wohlstand ins Herz des Commonwealth aufgemacht hatten, sondern auch das Potential zu einem Konflikt, der bis heute nicht beigelegt werden konnte, wie ein einziger Blick in ein Flüchtlingslager wie Lampedusa zeigt. Denn damals, nur drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, zeichnete sich nicht nur weltweit das langsame Erlöschen der Kolonialherrschaft ab, sondern sie hörte auch auf, eine Einbahnstraße zu sein: Die Kolonisierten machten sich auf den Weg in die Heimat ihrer Kolonisatoren. Sie kamen als geladene Gäste, deren Arbeitskraft gebraucht wurde, aber empfangen wurden sie zu ihrer grenzenlosen Überraschung wie Eindringlinge. Diese traumatische Erfahrung, die sich millionenfach wiederholen sollte, hatte gewaltige Folgen. Auch für die Literatur.
Im April 1948 war in einer Tageszeitung auf Jamaika eine Anzeige erschienen, in der Arbeitswilligen nicht nur ein Job, sondern auch eine günstige Überfahrt nach England in Aussicht gestellt wurde. Aber rasch zeigte sich, dass die Immigranten als Angehörige des Commonwealth zwar in der Regel einen britischen Pass besaßen und somit keinerlei Einwanderungsbeschränkungen unterlagen, ansonsten aber keinesfalls als gleichberechtigte Bewohner des britischen Empire betrachtet wurden. Nicht wenige der Zuwanderer hatten im Krieg für König und Vaterland gekämpft, aber nun wurden sie angefeindet, gedemütigt, als unliebsame Konkurrenten behandelt und nicht selten aus rassistischen Motiven attackiert. London, die legendäre Metropole, von der kaum ein Zuwanderer eine realistische Vorstellung besessen hatte, erwies sich als kalter und feindseliger Moloch, dem der Krieg Wunden geschlagen hatte, in denen sich die Abstiegsängste der britischen Nation festsetzten wie Blutegel. Das war die Situation, in die sich die Passagiere der "Empire Windrush" versetzt sahen wie nach ihnen Millionen anderer. Das erste literarische Werk, das diese Situation zu seinem Thema machte, erschien 1956 und ist bis heute nichts ins Deutsche übersetzt worden: Sam Selvons "The Lonely Londoners".
Es dauerte weiter dreißig Jahre, bis mit dem späteren Literaturnobelpreisträger V. S. Naipaul ein Schriftsteller die prägende Formel für eines der traumatischen Schlüsselerlebnisse der Migration gefunden hatte: "Das Rätsel der Ankunft". Naipauls gleichnamiges Buch erschien 1987 im Original und noch im selben Jahr in deutscher Übersetzung.
Selvon, der aus Trinidad stammte, schilderte in seiner "tragikomischen Chronik" die Erfahrungen seiner Schicksalsgefährten, die in "The Lonely Londoners" nicht als Opfer ungünstiger Umstände und einer feindseligen Umgebung erscheinen, sondern als findige und anpassungsfähige Überlebenskünstler. Eine Generation später hat sich Naipaul von einer solchen Gegenüberstellung verabschiedet und versucht sich in seinem Buch an einer "Synthese der Welten und Kulturen, die mich geformt haben".
Die Entkolonialisierung muss als entscheidendes Element gelten, das zur Entstehung einer neuartigen literarischen Strömung beigetragen hat, die keineswegs auf Großbritannien beschränkt geblieben ist. Andere Faktoren kamen hinzu: Kriege, Vertreibung, Diktaturen, Wirtschaftskrisen und Hungersnöte, ethnische Konflikte, die Globalisierung mit all ihren Konsequenzen. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler hat diesem komplexen Phänomen nun eine umfangreiche Studie gewidmet: "Die neue Weltliteratur und ihre Erzählung" ist der Versuch, einen Überblick über jenen Teil der internationalen Literatur zu geben, der von Autoren verfasst wurde, die Migranten und Sprachwechsler sind, also ihre Heimat verlassen haben und ihre Bücher oft genug in einer Sprache verfassen, die nicht ihre Muttersprache ist. Entwurzelung, Entfremdung, Traditionsbruch und Kulturwechsel, Einsamkeit und Ablehnung sind die großen Themen dieser Bücher, deren Vielfalt in der Tat so groß ist, dass niemand für sich in Anspruch nehmen kann, diese "immense und weiter vor sich hin explodierende Materialmenge zu überblicken, geschweige denn zu meistern", wie Sigrid Löffler in ihrem Einleitungskapitel schreibt.
Aber wie geht man vor, wenn man es mit einer solchen Fülle des Materials zu tun hat und mit einer kaum zu überblickenden Anzahl wichtiger oder doch zumindest interessanter Autoren? Sigrid Löffler verfährt zunächst historisch-chronologisch, indem sie mit der Ankunft der ersten jamaikanischen Zuwanderer in England im Jahr 1948 beginnt und dann die drei großen Einwanderungswellen skizziert, mit denen England in der Nachkriegszeit konfrontiert war. Im Anschluss daran bringt sie Einzelporträts, etwa des Somaliers Nuruddin Farah, untersucht die Rolle, die Toronto und New York als klassische "Arrival Cities" zum Beispiel für jüdische Autoren aus der ehemaligen Sowjetunion spielen, und wendet sich im letzten Teil des Buches "Bürgerkriegen und Zerfallsgeschichten" zu, die an den Beispielen des Libanons und des ehemaligen Jugoslawiens verhandelt werden. Löfflers Schwerpunkt liegt also zunächst eindeutig auf "jenen Literaturen, die in den Ruinen des British Empire entstanden sind und von diesen - zumeist traumatischen - Hinterlassenschaften künden".
Diese Beschränkung ist verständlich, hat aber zur Folge, dass der nicht weniger spannende Bereich der frankophonen Literatur ausgeklammert wird, also Autoren wie Senghor, Glissant oder Marie N'Diaye keine Berücksichtigung finden. Und auch wenn Deutschland keine Kolonialmacht von der Bedeutung Englands und Frankreichs war, so gehören doch seit etlichen Jahren Autoren zur deutschsprachigen Literatur, die wie Naipaul oder Rushdie zu den "Sprachwechslern" und "Luftwurzlern" gezählt werden können. Dass Sigrid Löffler, die doch für ein deutschsprachiges Publikum schreibt, Autoren wie Terézia Mora, Feridun Zaimoglu, Sherko Fatah, Ilija Trojanow oder Emine Sevgi Özdamar kein eigenes Kapitel wert sind, ist mehr als bedauerlich.
Doch es bleiben immerhin rund fünfzig Schriftsteller und ihre Werke, die hier beschrieben und eingeordnet werden: Moderne Klassiker wie Doris Lessing, Chinua Achebe, J. M. Coetzee, V. S. Naipaul und Salman Rushdie, postmoderne Autoren wie Hanif Kureishi und Mohammed Hanif, in Deutschland noch immer zu wenig bekannte Schriftsteller wie der Inder Kiran Nagarkar, und schließlich die junge Generation, deren Angehörige mit dem postkolonialen Diskurs abgeschlossen haben und stattdessen wie Mohsin Hamid, Teju Cole und Taiye Selasi einem modernen Kosmopolitismus anhängen, der durchaus elitäre Züge aufweist. Sigrid Löffler stellt sie vor, skizziert ihre Entwicklung, referiert ihre Werke und zeigt gelegentlich, wie etwa im Fall der in Nigeria aufgewachsenen und heute teilweise in den Vereinigten Staaten lebenden Chimamanda Ngozi Adichie, auch die Traditionslinien auf, denen die Autoren verpflichtet sind.
Weil sie nicht einen Autor nach dem anderen abhandelt, geht es mitunter sprunghaft und nicht selten auch redundant zu. Wertungen und klare Urteile bleiben die Ausnahme, in der Fülle der Details verschwimmen die großen Linien, die gezogen werden müssten. So wird die Lektüre nach höchst anregendem Beginn schon nach halber Strecke zu einer freudlosen und auch ein wenig mühsamen Angelegenheit.
Sigrid Löfflers Literaturkenntnisse sind ohne Zweifel beeindruckend, und Respekt gebietet auch der Mut, mit dem sie sich an ihren Gegenstand gemacht hat. Eine profunde, für breitere Leserkreise geschriebene Auseinandersetzung mit dem Thema der "neuen Weltliteratur" war überfällig und hat auf ihren Autor gewartet. Doch Löfflers Buch weist zu viele offenkundige Mängel auf. Je unübersichtlicher das Feld, desto wichtiger ist es, die Grundbegriffe zu klären, mit denen es beackert werden soll. Wird der von Goethe geprägte Begriff "Weltliteratur" heute wirklich so eindeutig verwendet, dass man kein Wort über ihn verlieren muss? Wären nicht seitenlange Inhaltsangaben zu den Werken Doris Lessings entbehrlicher gewesen als eine kurze Einführung in die postkoloniale Literaturtheorie? Ist es nicht ein wenig fahrlässig, einen Begriff wie den der "Hybridität" so unbekümmert zu verwenden, dass nicht einmal ein Hinweis auf seine Herkunft und seinen umstrittenen Gebrauch für nötig erachtet wird?
Ein Ärgernis ist die erstaunliche Anzahl von Binsenweisheiten. So heißt es etwa in der Einleitung: "England ist heute nicht mehr, was es vor sechzig Jahren war." Für welches Land der Welt würde dieser Satz nicht gelten? Irritieren muss auch die zum Teil gedankenlos wirkende Übernahme überholter Sprachmuster: Wenn "arme Schlucker aus Übersee" in ihren "dünnen Tropen-Klamotten" darauf warten, dass es endlich Sommer wird und die englischen Mädchen "ihre Sommerfähnchen hissen und bereit sind, sich im Hyde Park mit hübschen Boys aus der Karibik in die Büsche zu schlagen", ist das eine Anhäufung altbackener Klischees, die man im Zusammenhang dieses Buches wahrlich nicht erwartet hätte.
Man muss es leider so deutlich sagen: So verheißungsvoll Sigrid Löffler ihr Vorhaben im Einleitungskapitel ankündigt, so enttäuschend ist oft dessen Umsetzung. Angekündigt wird die Kartografierung von Literaturlandschaften, "doch so, dass sie in Literaturerzählungen überführt werden. Literaturgeschichte wird in Form von Literaturgeschichten dargestellt, wobei der kulturelle Resonanzraum immer mit anklingt. Der Kontext zu den Texten wird mit angesprochen. Und die Politik liefert die Hintergrundgeräusche." Wie das klingt, zeigt sich zum Beispiel auf Seite 61, wenn Salman Rushdies mühsamer Weg zu einer "überlegenen kosmopolitischen Gelassenheit" skizziert wird und es heißt: "Die 1980er Jahre waren das Jahrzehnt Margaret Thatchers. Unter ihrer Regierung hatten Zuwanderer wenig zu lachen." Ein wenig mehr Hintergrundgeräusch hätte es da schon sein dürfen.
Sigrid Löffler: "Die neue Weltliteratur und ihre Erzähler".
C. H. Beck Verlag, München 2013. 344 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Katharina Granzin hatte sich von Sigrid Löfflers "Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler" mehr erwartet, zum einen, weil sie die Autorin als Herausgeberin der Zeitschrift "Literaturen" sehr schätzt, zum andern, weil der Titel so vollmundig Großes verspricht. Wäre sie ohne Erwartungen an dieses Buch gegangen, wahrscheinlich hätte es ihr gefallen, vermutet die Rezensentin, die Zusammenfassungen der Bücher von etwa V.S. Naipaul oder Ngugi wa Thiong'o fand sie schließlich alle sehr schön. Aber Granzin vermisst den roten Faden: weder führt Löffler aus, was das Spezifische dieser "neuen Literatur" sei, noch gibt sie einen angemessenen Überblick über so etwas wie eine "Literatur mit migrantischem Hintergrund", wenn es denn nur darum ging, erklärt die Rezensentin. Für ein stimmiges Buch hätten Verlag und Autorin mehr tun müssen als "Literaturen"-Manuskripte "an den Rändern zu tackern", meint Granzin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Es ist ein notwendiges, geradezu fälliges und überfälliges Buch. Ich werde die "Weltliteratur" zu meinen Nachschlagewerken stellen und jedes Mal, wenn ich es benutze, dankbare Stoßseufzer senden. Ihre Konzeption, die angloamerikanische Migrationsliteratur exemplarisch darzustellen, ist so richtig. Die Phänomene sind dort im Unterschied zu unseren relativ verspäteten Verhältnissen bereits voll ausgebildet. Werke wie das Naipauls lassen sich schon im Überblick betrachten und damit das ganze Spektrum der Verwerfungen studieren, die sie beobachtet." -- Sybille Cramer, Jurorin der SWR-Bestenliste 16.12.2013
"Ich habe gerade die Lektüre [des] Buches beendet und dabei erstens ein großes Vergnügen gehabt und zweitens sehr viel gelernt, ja mehr als das, eine Erweiterung meines Horizonts erfahren, meines Weltwissens. Das Vergnügen verdankt sich ihrer sicheren Darstellungs- und Benennungskunst und das Gelernte ihrer fabelhaften Belesenheit und Fähigkeit, das Gelesene in Erkanntes und Begriffenes zu überführen. Das Buch ist wichtig, notwendig und kommt zur richtigen Zeit. Eine Pioniertat. Vor ihr hat sich niemand auf dieses Terrain gewagt. Ich jedenfalls möchte dafür danken." -- Sybille Knauss, Schriftstellerin ("Fremdling") 20.12.2013
"Ich habe gerade die Lektüre [des] Buches beendet und dabei erstens ein großes Vergnügen gehabt und zweitens sehr viel gelernt, ja mehr als das, eine Erweiterung meines Horizonts erfahren, meines Weltwissens. Das Vergnügen verdankt sich ihrer sicheren Darstellungs- und Benennungskunst und das Gelernte ihrer fabelhaften Belesenheit und Fähigkeit, das Gelesene in Erkanntes und Begriffenes zu überführen. Das Buch ist wichtig, notwendig und kommt zur richtigen Zeit. Eine Pioniertat. Vor ihr hat sich niemand auf dieses Terrain gewagt. Ich jedenfalls möchte dafür danken." -- Sybille Knauss, Schriftstellerin ("Fremdling") 20.12.2013