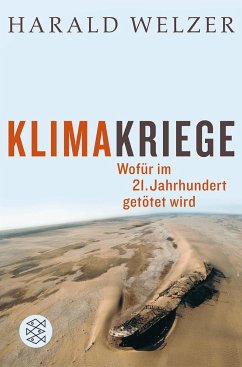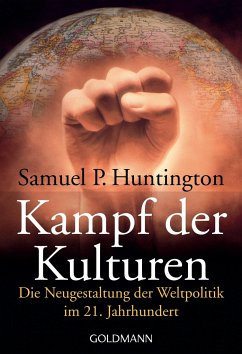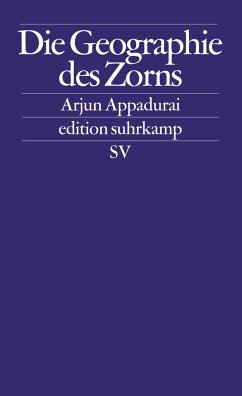Die neuen Kriege

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Jetzt schon ein politisches Standardwerk!
Das Zeitalter der zwischenstaatlichen Kriege geht offenbar zu Ende. Aber der Krieg ist keineswegs verschwunden, er hat nur seine Erscheinungsform verändert. In den neuen Kriegen spielen nicht mehr die Staaten die Hauptrolle, sondern Warlords, Söldner und Terroristen. Die Gewalt richtet sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung; Hochhäuser werden zu Schlachtfeldern, Fernsehbilder zu Waffen. Herfried Münkler macht die Folgen dieser Entwicklung deutlich. Er zeigt, wie mit dem Verschwinden von klassischen Schlachten und Frontlinien auch die Unterscheidung von Krieg und Frieden brüchig geworden ist, und erörtert, wie man den besonderen Gefahren begegnen kann, die von den neuen Kriegen ausgehen.