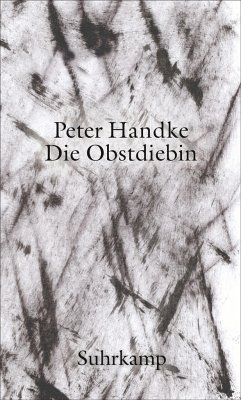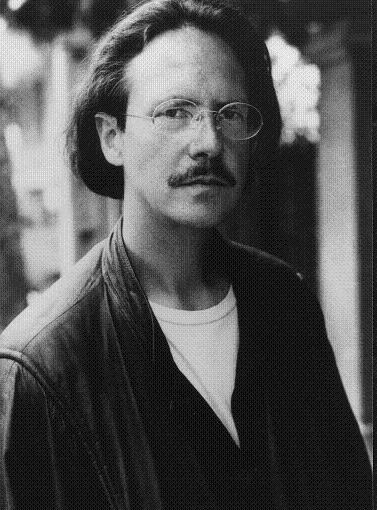Als das »Letzte Epos« (mit großem »L«) hat Peter Handke seinen neuen Roman bezeichnet. Mit der Niederschrift begann er am 1. August 2016: »Diese Geschichte hat begonnen seinerzeit an einem jener Mittsommertage, da man beim Barfußgehen im Gras wie eh und je zum ersten Mal im Jahr von einer Biene gestochen wird.« Dieser Stich wird, wie der Autor am 2. August festhält, zum »Zeichen«. »Ein gutes oder ein schlechtes? Weder als gutes noch als ein schlechtes, gar böses - einfach als ein Zeichen. Der Stich jetzt gab das Zeichen, aufzubrechen. Zeit, daß du dich auf den Weg machst. Reiß dich los von Garten und Gegend. Fort mit dir. Die Stunde des Aufbruchs, sie ist gekommen.«
Die Reise führt aus der Niemandsbucht, Umwegen folgend, sie suchend, in das Landesinnere, wo die Obstdiebin, »einfache Fahrt«, keine Rückfahrt, bleiben wird, oder auch nicht?. Am 30. November 2016, dem letzten Tag der Niederschrift des Epos, resumiert Peter Handke die ungeheuerlichen und bisher nie gekannten Gefahren auf ihrem Weg dorthin: »Was sie doch in den drei Tagen ihrer Fahrt ins Landesinnere alles erlebt hatte: seltsam. Oder auch nicht? Nein, seltsam. Bleibend seltsam. Ewig seltsam.«
Die Reise führt aus der Niemandsbucht, Umwegen folgend, sie suchend, in das Landesinnere, wo die Obstdiebin, »einfache Fahrt«, keine Rückfahrt, bleiben wird, oder auch nicht?. Am 30. November 2016, dem letzten Tag der Niederschrift des Epos, resumiert Peter Handke die ungeheuerlichen und bisher nie gekannten Gefahren auf ihrem Weg dorthin: »Was sie doch in den drei Tagen ihrer Fahrt ins Landesinnere alles erlebt hatte: seltsam. Oder auch nicht? Nein, seltsam. Bleibend seltsam. Ewig seltsam.«
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Lothar Müller hat sich gern mit Peter Handkes "Obstdiebin" auf den Weg gemacht, um "Lesefrüchte" zu pflücken. Ohnehin schätzt der Kritiker Handkes Erzählungen für die Kunst der "Augenblicke und Schrecksekunden". Davon gibt es im neuen Text allerhand, meint er. Mit dem Finger auf der Landkarte die Stationen von Handkes Heldin abschreitend zwischen Chaville und Picardie erlebt Müller Abenteuer und kommt in Berührung mit dem Mythos noch an den profansten Plätzen, am Spielplatz vor dem Bahnhof, im Supermarkt. Nicht der Gehalt der Erzählung (der Weg der Heldin zu einer Familienfeier) ist für den Rezensenten das Entscheidende, sondern der Satzbau, der laut Müller den Rhythmus des Voranschreitens imitiert. Wie der Autor damit den Kurzsatzstil auf die Plätze verweist und weiter gegen den Bildverlust anschreibt, findet Müller nach wie vor lesenswert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Peter Handke und Botho Strauß sind die Monolithen der deutschen Literatur: Jeder ein Fels für sich. Warum sie sich vollkommen fremd und doch ohneeinander nicht zu denken sind, zeigt Handkes neuer Roman "Die Obstdiebin"
Aus dem geistigen Mittelgebirge der deutschsprachigen Literatur ragen zwei Gipfel heraus, einsam und schroff: Botho Strauß und Peter Handke. Jeder von beiden ein Fels für sich. Und doch kann man den einen nicht ohne den anderen denken. Es ist, als hätte jeder eben das im Übermaß, was dem anderen fehlt. Bei Strauß: die Intellektualität, die Schärfe, der analytische, fassadenfressende Blick. Bei Handke: das Erzählenwollen, Erzählenmüssen, die O-Mensch-Geste, der Prosa-Gesang. Undenkbar, dass der eine auf den anderen zugeht, sich ihm gar anverwandelt. Und doch geben sie sich gegenseitig Kontur: als die beiden letzten überlebenden Varianten dessen, was bei uns einmal "Genie" hieß oder, bescheidener, Dichter. Im staatlich geschützten Biotop aus Lyrikern und Prosaisten, Stadtschreibern, Stipendiaten und Akademiemitgliedern sind sie die abwesenden Sendboten vom Parnass.
Schon die Orte, an denen sie wohnen, sagen viel über ihr Verhältnis zur Welt. Botho Strauß hat sich entschlossen, in der Wildnis seines Landes zu leben, am Rand der Uckermark, im tiefen Osten vor den Toren Berlins. Hier züchtet er die erlesenen Früchte seiner Lektüren und seiner Ranküne: "Auf ihrem Heimweg vergoß eine Schale Zorn die hagere, pferdgesichtige Frau, klackerte auf ihren Absätzen durch die nächtliche Gasse, schnauzte ihre Wut in die Hauseingänge." - "Unterm Lichthut versinnst du dich mit den Jahren in das Weiß bei Plotin" (aus "Oniritti"). Handke dagegen haust im Exil am Stadtrand von Paris, in der "Niemandsbucht" im Seinebogen, um den nötigen Abstand zu seiner intellektuellen und biographischen Herkunft zu halten, der seiner Prosa ihre sehnsüchtige Spannung gibt. Er lebt in Frankreich und schreibt auf Deutsch, weil sein ganzes Werk ein Werk des Heimwehs ist - nach einem Ort, der zugleich in der Welt und außerhalb der Welt ist, im Hier und Heute und außerhalb der Zeit.
Dieser Ort kann ein Spielplatz sein (in der "Stunde der wahren Empfindung") oder ein Holzstapel (in "Langsame Heimkehr"), eine Kneipe mit einer Jukebox (im "Versuch über die Jukebox") oder das "neunte Land" hinter den Bergen der Kindheit. Immer aber trägt er die Signatur einer profanen Offenbarung: Wer ihn findet, ist für einen Moment von allen Schmerzen, allen Zweifeln, allem Hass und aller Gier erlöst.
Die Tragödie des politischen Individuums Peter Handke besteht darin, dass er diesen Ort in den neunziger Jahren im zerbrochenen Jugoslawien gefunden hat. Deshalb ergriff er Partei für die Serben, die jenes Land zu verteidigen vorgaben, deshalb schloss er Freundschaft mit Mördern, deshalb färbten sich die "andersgelben Nudelnester" seiner Serbienreise mit dem Blutton von Srebrenica. Handkes Prosa freilich ist von diesem lebensgeschichtlichen Irrweg unberührt geblieben. Ja, vielleicht hat ihn der donquichotteske Kampf gegen die moralische Mehrheit im Jugoslawienkonflikt sogar beflügelt, indem er ihn endgültig der Verpflichtung enthob, die Literatur Österreichs, die deutsche Sprachgemeinschaft, die europäische Kultur oder irgendetwas anderes zu repräsentieren. Jedenfalls schreibt Handke, seit er nur noch für sich selbst steht, gelöster und unverkrampfter als je zuvor.
"Die Obstdiebin", Handkes neuer Roman, beginnt mit einer Schrecksekunde: Der Erzähler wird im Garten von einer Biene gestochen. Doch es tut nicht weh, denn derlei stößt ihm "seit jeher" im Sommer zu; außerdem, hofft er, wird das Gift seine taub gewordenen Zehen wenigstens "eine Zeitlang wiederbeleben". Aber der Stich will gelesen werden. Er gibt "das Zeichen, aufzubrechen". Wer sagt das? "Ich. Ich beschloss es." Die Erzählung braucht keinen Stoff, sondern einen Anlass. Sie bringt sich selbst in Gang.
Es ist der Sommer 2016. Frankreich wird von einer Terrorwelle heimgesucht: die Messerattacke in Magnanville, der Anschlag von Nizza, die Ermordung des Priesters in der Normandie. Die Furcht, die der Terror auslöst, schreibt sich der Erzählung ein. Zuerst ist da nur eine drückende Stille, "wie die Druckwelle einer weltweiten Katastrophe". Später wird der Druck konkret. Vor dem Bahnhof in Versailles stehen bewaffnete Polizisten, die bei jedem lauten Geräusch aufhorchen. Im Vorortzug fällt ein Fahrrad um, und es klingt wie ein Schuss. Dann bleibt der Zug stehen. Erschrocken blicken sich die Fahrgäste an: "Wieder ein Streik? Oder ein Terroralarm?" Handkes Figuren mögen Weltflüchtige sein, doch sie leben in dieser, in unserer Welt.
Aber noch eine weitere Furcht treibt den Erzähler an. Es ist die Befürchtung, nichts mehr zu sagen zu haben, zum Verwalter, zum Denkmal des eigenen Schreibens zu werden. "Das Geleistete verduftet, und ich in seinem staubtrockenen Sog geschwächt, schwächer nicht möglich". Zugleich weckt die Betrachtung der eigenen "Werkstücke" (also Bücher) das Verlangen, das Kunststück von damals, die Entgrenzung, zu wiederholen. So beginnt die Reise mit zwiespältigen Gefühlen: "Sehnsucht und Beklommenheit".
Die Anspannung entlädt sich in einem Bahnhofscafé. Zwischen den Stammgästen sitzend, bricht aus dem Erzähler der alte Handke-Hass - der, mit anderen Akzenten, auch der Hass von Botho Strauß ist - auf die Menschheit im Allgemeinen heraus, die für jeden Zuspruch taub ist: "Nichts wundert sie. Nichts macht sie aufhorchen." Aber, und hier trennen sich die Wege von Handke und Strauß, der Erzähler der "Obstdiebin" will diese "soundsoviel Milliarden unerreichbarer Zweibeiner" mit seinen Worten rühren. Zugleich weiß er, dass dieser Wunsch "nackter Unsinn" ist. Deshalb träumt er von einer Folterkammer, in der ihm all die Unerreichbaren in "einem lichtlosen Schrank, gefesselt und geknebelt", zuhören müssten. Was natürlich ebensolcher Unsinn ist.
Aber der Erzähler Handke braucht diesen Folterschrank gar nicht, um wieder Anschluss an die Menschheit zu gewinnen. Er muss sich nur verwandeln: sich und seine Geschichte. Es ist "ein Umschwung ins Höhere und Offene, ein Schwingen weg von all dem Definierten ins Undefinierbare", der so passiert. Man könnte auch sagen: eine Fiktion. Der Erzähler erfindet sich eine Gestalt. Er gibt ihr einen Namen: "Die Obstdiebin". Und dann folgt er ihrem Weg.
Die Obstdiebin - später erfahren wir, dass sie Alexia heißt - fällt nicht vom Himmel, sondern steigt aus dem Fundus von Handkes Phantasie: So viel Wiederholung muss sein. Sie ist die Tochter der "Bankfrau", die im Roman "Der Bildverlust" von 2002 in der Sierra de Gredos unterwegs war; und so wie diese damals ihre Tochter suchte, sucht jene jetzt nach der Mutter. Auch der getrennt lebende Vater tritt auf, ein Hobby-Historiker und verhinderter Volksredner, der einem aus vielen Handke-Büchern bekannt vorkommt, und dazu der Bruder, der sein Studium abgebrochen hat, um eine Lehre als Bauschreiner zu beginnen. Trotzdem ist "Die Obstdiebin" kein Familienroman. Es geht nicht um Beziehungen. Es geht um Erfahrungen, um den Gang durch eine Landschaft in einer bestimmten Zeit, mit Einschüben von Zeitlosigkeit.
"Die Welt, das war die Dreiecksgeschichte zwischen einem selber, der Natur und den Anderen." Um an diese Anderen heranzukommen, ohne ständig von "einem selber" reden zu müssen, holt der Erzähler Alexia auf die Bühne. Sie ist seine Muse, seine Maske und sein Medium, und im Traum, der beide "von ihren gegenseitigen Leibern erlöst und zur gleichen Zeit ganz Körper" sein lässt, wird er ihr Liebhaber. Doch sie trägt auch, obgleich "blutjung", seine Altlasten mit sich herum. "Die Zeit war ein Stoff, ein guter und lieber . . . Ihr jetziger Zustand aber hieß: Unzeit." - "Alles war gegen sie, und sie war gegen alles." Aber statt sich ihrem Überdruss grübelnd zu ergeben, lebt sie ihn aus: in der Natur, der Landschaft.
"Die Obstdiebin" beginnt mit einem Zitat aus Wolfram von Eschenbachs Ritter-Epos "Willehalm", das viele Rezensenten auf die Suche nach versteckten Bezügen geschickt hat. Dabei ist, natürlich, Wolframs anderes, bekannteres Epos der Bezugspunkt: der "Parzival". Die Geschichte vom reinen Toren, seinen Abenteuern, seiner Schuld, seiner Erziehung durch das Leben. Ein Bildungsroman.
Die Obstdiebin läuft von Cergy-Pontoise über Courdimanche, Osny und Chars nach Chaumont-en-Vexin. Ihre Route, etwa eine halbe Autostunde, kann man auf der Karte nachschlagen. Über die "Schlacht im Vexin", die letzte, sinnlose Gegenoffensive der geschlagenen Wehrmacht nördlich von Paris, hat der im Roman erwähnte "Parisien" im August 2016 berichtet. Zeitbezüge, Daten, historische Klammern überall. Dann aber ermahnt sich der Erzähler, "jede Ansteckung mit alten stories", selbst den biblischen, zu vermeiden. Auch die Naturbeschreibungen, sonst die Kronjuwelen in Handkes Prosa, fallen diesmal eher spärlich aus. Dieser Roman malt keine Landschaften. Er zeichnet Figuren.
Da ist die Dorfschullehrerin, die einen Krimi schreiben will, "Die Mutter aller Morde", und sich dann entschließt, das Geheimnis der Landschaft lieber nicht an eine mystery story zu verraten. Der Familienvater, der verzweifelt seine Katze sucht und sie ohne jeden Dank von der Finderin entgegennimmt. Der Gastwirt, der sein verfallendes Hotel an der Staatsstraße wiedereröffnen will, um die Autofahrer der Welt zu verköstigen. Vor allem aber der Pizzabote, der seinen Scooter stehen lässt, um mit Alexia übers Land zu gehen. In ihm hat Handke eine Gestalt des gegenwärtigen Unheils zu skizzieren versucht. Im Hotel, vor der Jukebox, träumt der Bote von Selbsttötung. Da zieht ihn die Obstdiebin in einen Tanz hinein, den er als Geheilter verlässt. Von allen Gesten in diesem Buch ist das die gewinnendste, weil sie ohne Pathos auskommt, ohne Sprachmagie, weil sie ganz Aktion und Bewegung ist und doch viel mehr.
Die Obstdiebin und ihr Vater, der Pizzabote, der Katzensucher, die Lehrerin. Auch bei Botho Strauß könnte man solchen Menschen begegnen. Aber er würde sie am Faden einer Sucht, eines Ticks, einer Verletzung, einer Pferde- oder Katzengesichtigkeit tanzen lassen. Bei Handke bekommen sie, was sie bei Strauß nicht haben: Atem. Der Erzähler entreißt ihnen nicht ihr Geheimnis. Der Preis, den er für diese Zurückhaltung zahlt, ist Unschärfe. Keine von Handkes Figuren prägt sich tiefer ein, auch die Obstdiebin nicht. Ihr größter Moment ist ein Duell, das sie kurz vor dem abschließenden Familienfest mit ihrer Doppelgängerin in der Arena eines abgebauten Zirkuszelts austrägt. Die beiden fetzen sich wie die Androidenknaben in Spielbergs "A. I.", mit "Totschlagswut" im Blick. Die Obstdiebin wirbelt wie ein "Meteorstein" und bleibt Siegerin. Am Ende ist der Kampf mit dem eigenen Spiegelbild doch das härteste Parzival-Erlebnis.
Was haften bleibt, sind die Momente, in denen die Geschichte stillsteht. Die Bahnhofsuhr von Cergy, durch die der Abendhimmel durchscheint. Der Wald, der sich wie ein Naturkäfig über den Wanderern schließt. Das Aufglühen von Wolkenfetzen, der Tanz der drei Fremden. Und die Suaden, die Verfluchungen und Anrufungen der Menschheit, der Geschichte, der Erzählung, der Autofahrer, der Staatenlosen. "Lasst uns ein Volk sein heute", sagt der Vater in seiner langen, wirren Festrede, nach der die Geschichte wie ein müdes Kind die Augen schließt - "ein anderes, das machtlose, vor dem Zifferblatt der Anderen Zeit." Da ist Handke wieder ganz nah bei Botho Strauß. Auch der träumt ja von der Gemeinschaft der Wissenden, der Eingeweihten, vom großen Anderswo, an dem die Jetztzeit, die böse, seinsvergessene, aufgehoben ist. Die Eremiten der deutschen Literatur, der Monolith und die Monade, sie wollen einen Bund stiften, jeder für sich. "Eine Partei gründen? Die Partei der Obstdiebe? Aber gab es die nicht schon?" Es gibt sie. Sie heißt Poesie.
ANDREAS KILB.
Peter Handke: "Die Obstdiebin oder Einfache Fahrt ins Landesinnere". Suhrkamp, 559 Seiten, 34 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Sehr reizvoll ist, dass die 'Obstdiebin' über die ganze Erzählung hinweg zwischen einer Figur aus Fleisch und Blut und einem Phantasma schillert ...« Jan Wiele Frankfurter Allgemeine Zeitung 20171116