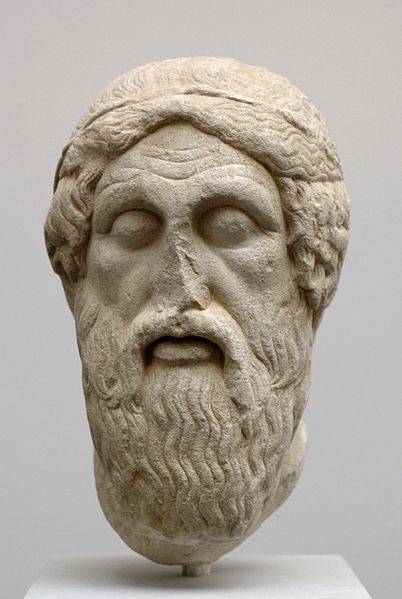Keck: Homers "Odyssee", von Christoph Martin neu erzählt
Homers "Odyssee" also - "neu erzählt". Tatsächlich, um es sofort zuzugeben, bewähren sich die alten Geschichten um die zögerliche Heimkehr des Odysseus auch hier: "Det Zeuch is nich totzukriejen" murmelte Max Liebermann nach einer nicht sehr guten Aufführung von Beethovens Neunter. Und wahr ist auch, daß uns Wolfgang Schadewaldts bewundernswerte Übersetzung "in deutsche Prosa" von 1958 deutlich ferngerückt ist: sie wirkt jetzt ein wenig "edel". Er wollte, wie Schleiermacher dies gefordert hatte, eine Übersetzung, die "das Fremde spürbar macht, ohne zu befremden".
Das will nun Christoph Martin weniger (so sagt man im Schwäbischen, wenn man meint: überhaupt nicht). Oder sagen wir es so: Das "Fremde" kann Martin nicht wegschaffen, und eigentlich will er dies auch nicht, und "befremden" tut er nicht, wie Schadewaldt, durch eine "ferne Sprachwelt", sondern umgekehrt durch keck plazierte Modernismen. Wiederherstellen will er, meint Heiner Boehncke in seinem äußerst großzügigen Nachwort, den "nicht selten respektlosen, ironischen Gestus" (ohne "Gestus" geht es nicht), "der etwa das Verhältnis zu den Göttern kennzeichnet". Der sei denen entgangen, die sich dem "Geist der Antike" so nahe wähnten. Lassen wir das auf sich beruhen. Egon Friedell meinte (es ist aber geistvoller Unfug), die Götter der Griechen seien schon von Anfang an von Offenbach gewesen. So weit wie Boehncke war er also schon.
Nehmen wir die berühmte "philosophische" Stelle zu Beginn. Es redet Zeus bei der Versammlung der Götter. Martin erzählt es auf diese Weise neu: "Der Vater der Menschen und der Götter nahm das Wort... Und er plauderte ein wenig aus der hohen Schule: ,Ach, wie gewöhnlich! Die Sterblichen beklagen sich wieder mal über uns. Für alle Übel wollen die Menschen den Göttern die Schuld in die Schuhe schieben! Dabei ist es doch meistens ihre eigene Dummheit und nicht das Schicksal, worunter sie leiden. Das beste Beispiel ist Aigisthos ...'". Bei Schadewaldt hieß dies: "Unter ihnen begann die Reden der Vater der Menschen und der Götter ... und sprach unter den Unsterblichen die Worte: ,Nein! Wie die Sterblichen doch die Götter beschuldigen! Denn von uns her, sagen sie, sei das Schlimme! und schaffen doch auch selbst durch eigene Freveltaten, über ihr Teil hinaus, sich Schmerzen. So hat auch jetzt Aigisthos, über sein Teil hinaus ...'".
Das war also bei Schadewaldt viel genauer: Da ist einmal das von den Göttern Verhängte, dann aber, sehr unnötig dazukommend, was die Menschen sich selbst durch "eigene Freveltaten" an Unglück schaffen - "über ihr Teil", also über das ihnen ohnehin Zugewiesene, "hinaus". Wer Schadewaldt selbst noch gehört hat, vergißt nicht, wie er das "über" hier, mit bedeutend erhobener Hand, vorlesend betonte. Bei Martin ist da nur die ungenaue Alternative "Schicksal" oder "meistens eigene Dummheit". Und "Dummheit" ist ja auch etwas wenig für die doppelte, freilich zusammenhängende Untat des Aigisthos, der den heimkehrenden Agamemnon tötete, nachdem er ihm zuvor die Frau genommen.
Die kurze Probe macht auch andere Unterschiede klar. Martin bleibt durchaus bei der Sache, setzt aber immer wieder flotte Lichter: "plauderte ein wenig aus der hohen Schule", "Ach, wie gewöhnlich!" (bei Schadewaldt bloß "Nein!"), "wieder mal", "in die Schuhe schieben". Und so geht das weiter mit wechselndem Glück - über den Text hinaus.
Also man braucht, das ist schon richtig, für Martins Neuerzählung etwas Humor. In ihrer Art ist sie aber wirklich nicht ungekonnt, sie macht bald Spaß, oder der Spaß, den Martin beim "Neu-Erzählen" ganz offensichtlich hatte, überträgt sich. Und ohne Humor war Homer oder waren die mehreren Homere ja auch nicht.
Andere Beispiele für Martins Flottheiten? Da gibt es Ausschweifungen, regelrechte Enthemmungen. Über Laodamas etwa, den Phaiaken: "Er überzeugte wirklich auf ganzer Linie durch quasi göttliches Aussehen." Oder Odysseus sagt über jemanden, er benehme sich als "soziale Null". Oder Agamemnon in der Unterwelt zu seinem alten Freund, der zusammen mit den durch Odysseus umgelegten Freiern dort erscheint: "Was ist passiert, Amphimedon, daß so viele herausragende Fürsten gleichzeitig unter die dunkle Erde kommen? Und alle im gleichen Alter? Ich selbst könnte keine bessere Auswahl der Hautevolee eurer Stadt zusammenstellen!" Schließlich beendet den oben in Ithaka tobenden Kampf keine geringere als Athene, indem sie nämlich "mit maximaler Phonstärke dazwischenfunkt". Und kurz zuvor gelingt es Martin gar, in den Worten von Zeus Helmut Kohl gewaltig unterzubringen. Die Leute von Ithaka, meint der Vater aller, "sollen in Zukunft wieder mehr an Liebe, Frieden und blühende Landschaften denken". Bei Schadewaldt hieß es (das war eben lange vor Kohl): "Es soll Reichtum und Friede in Fülle sein!"
Ob "junge Menschen" oder auch ältere, die diesen Berg noch nicht bestiegen haben, sich durch diese Neuerzählung zu ihm führen lassen? Oder ob Martins kecker Versuch doch nur, wie zu befürchten, bereits Überzeugte überzeugt? Es wäre schön, "ächt", wenn auch das erstere vorkäme. Und übrigens: Schadewaldt und auch den alten Voß (und die anderen) nimmt Christoph Martin, Jahrgang 1952, ja niemandem weg.
Homer: "Die Odyssee". Neu erzählt von Christoph Martin. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2003. 391 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit gewissem Respekt, aber nicht gänzlich begeistert würdigt Rezensent Hans-Martin Gauger diese kecke und respektlose Neuübersetzung. In ihrer Art findet er sie zwar nicht ungekonnt, und der Spaß, den Christoph Martin wohl beim Übersetzen hatte, überträgt sich, lesen wir, auch auf den Rezensenten. Kein Homer ohne Humor sozusagen. Größter Mangel ist für Gauger aber, dass es dem Neuübersetzer nicht gelingt, "das Fremde spürbar zu machen, ohne zu befremden", wie es schon Schleiermacher gefordert habe. Stattdessen bringe Martin das Kunststück fertig, in den Worten des Zeus einmal sogar ein berühmtes Helmut-Kohl-Zitat unterzubringen. Deshalb spricht er die Befürchtung aus, die vorliegende Fassung werde möglicherweise nur bereits Überzeugte überzeugen. Auch das Nachwort findet er etwas zu großzügig (sprich: lobhudelnd) geraten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Seit wir Schadewaldt haben, sind wir fürs Erste alle Sorgen eines deutschen Homers wegen ganz los. Die Zeit