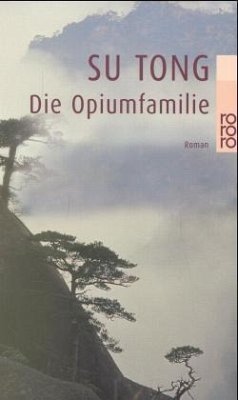Durch Brudermord und Betrug ist Liu Laoxia zum reichsten Großgrundbesitzer der Gegend und Herrscher über das südchinesische Dorf Fengyang aufgestiegen, doch er ist unfähig, gesunde männliche Nachkommen zu zeugen. Von seinen fünf Söhnen kamen vier mißgebildet zur Welt, nur der fünfte, Yanyi, ein Idiot, durfte überleben. Die Bauern erzählen sich, dies sei die Strafe dafür, daß Liu Laoxia fast alle Mädchen des Dorfes geschändet und seinen eigenen Vater ermordet habe, um dessen Konkubine zu seiner Ehefrau zu machen. Erst mit der Geburt des sechsten Kindes, Chancao, dessen leiblicher Vater der Vorarbeiter Chan Mao, der Liebhaber von Liu Laoxias Frau, ist, scheint die Generationenfolge gesichert zu sein. Im Alter von zwanzig Jahren übernimmt Chancao das Gut. Doch schon längst hat der durchdringende süße Duft des Schlafmohns von ihm Besitz genommen, längst ist er opiumsüchtig, verweichlicht und nicht in der Lage, das Gut allein zu verwalten...

Revolution im Sauseschritt: Su Tongs Roman "Die Opiumfamilie"
Su Tong gehört zu den bekanntesten Autoren Chinas. Seine Erzählung "Die rote Laterne" - oder vielmehr deren Verfilmung von Zhang Yimou - wurde zu einem weltweiten Erfolg. Verfilmt wurde auch Su Tongs Roman "Reis"; der Film darf in China nicht gezeigt werden. Die kruden Details dieser Familiengeschichte passen nicht in die festen Vorstellungen der chinesischen Kulturaufpasser.
"Reis" erschien vor eineinhalb Jahren bei Rowohlt auf deutsch; jetzt hat der Verlag einen zweiten Roman von Su Tong nachgelegt. Die Lektüre der "Opiumfamilie" ist ein kurzes Vergnügen - 140 Seiten umfaßt das Bändchen - und ein zweifelhaftes dazu. Erzählt wird im Geschwindschritt vom Untergang einer Grundbesitzerdynastie aus einem Dorf im Süden des Landes, einem "typischen Dorf", wie betont wird, durch Dekadenz, Selbstzerstörung und die siegreiche Revolution.
Zwischen 1930 und 1950, in der erzählten Zeit, brechen die jahrhundertealten Strukturen erst allmählich und dann immer schneller zusammen. Liu Laoxia, Oberhaupt der Familie, hat von Reis- auf Opiumanbau umgestellt, was seinen Reichtum mehrt, aber seinen Erben ruiniert: Den macht der Schlafmohn süchtig und willensschwach. Dieser Chencao ist eigentlich vom Vorarbeiter Chenmao gezeugt, weil Laoxia keinen gesunden Erben zustande bringt. Die Geburt des "falschen" Sohnes, mit der der Roman einsetzt, ist symbolisch und faktisch der Anfang vom Ende. In der Kreisstadt lernt Chencao zwar den späteren Brigadeleiter Lu Fang und über ihn die neuen marxistischen Ideen kennen. Statt sich aber ihnen zuzuwenden, wie es das sozialistische Drehbuch erfordern würde, kehrt Chencao ins Dorf zurück, tötet im Streit seinen debilen Halbbruder und dämmert fortan im Opiumrausch dahin.
Dann kommt die Revolution ins Dorf, angeführt von seinem alten Freund Lu Fang. Der macht den Arbeiter Chenmao zum Vorsitzenden der kollektivierten Bauern. Aus dem Underdog, der von der Herrschaft nur "Hund" genannt wurde und gelegentlich auf allen vieren laufen und bellen mußte, wird ein Machthaber. Er gebraucht seine Macht, um sich zu rächen: Er vergewaltigt die Tochter seines einstigen Herrn. Von Lu Fang zur Rede gestellt, rechtfertigt er sich: "Heißt Revolution, daß ich Liu Suzi nicht ficken darf?" Damit die neue Zeit siegen kann, müssen alle Vertreter der alten verschwinden, so die summarische Moral des Romans. Liu Laoxia verbrennt mit Frau und Tochter in der Binsenhütte, dem Ort seiner sexuellen Eskapaden, Chencao erschießt den Vergewaltiger Chenmao, ohne zu ahnen, daß es sein Vater ist, und wird seinerseits von Lu Fang "liquidiert" (so wörtlich).
Von ferne erinnert die Konstellation der Personen an die griechische Tragödie, auch eine Art Chor fehlt nicht; es ist das Publikum, vom Erzähler mit "ihr" angesprochen und zur Stellungnahme animiert. Die Kreuzung des Tragischen (oder auch nur Tragisch-sein-Sollenden) mit der revolutionären Überwindungs- und Tabula-rasa-Ideologie führt aber zu keinem literarisch haltbaren Ergebnis. Dabei enthält der Roman ein paar starke Symbole und einige Sätze, die auf drastische Weise vorführen, was Klassengesellschaft im vorrevolutionären China bedeutete und welche Tonnen an Haß sich über die Jahrhunderte in der Landbevölkerung angestaut haben müssen.
Aber wie ungelenk, wie unbeholfen ist das alles erzählt! Perspektive und Erzählhaltung werden nicht nur willkürlich gehandhabt, der Eindruck drängt sich sogar auf, daß dem Autor die Bedeutung eines entscheidenden literarischen Gestaltungsmittels gar nicht bewußt ist. Innen und außen, Distanz und Nähe, lehrhaft-plane Draufsicht und altertümlich gewandete Naivität gehen wild durcheinander. Auch stilistisch ist der Autor unsicher - oder sollte dies alles dem Übersetzer anzulasten sein? Daß dieser ausgesprochen unelegant formuliert, spürt man auch ohne Kenntnis des chinesischen Originals.
Es gibt keinen Ton, sondern viele Töne, die zusammen nicht klingen wollen. Mal wählt der nicht faßbare Erzähler die Distanz des Geschichtsschreibers, mal kriecht er in das dumpfe Bewußtsein des Idioten Yanyi hinein und läßt, mitten in dessen Verzweiflung, mitten in den Satz, ein chronikalisches "Das war 1930" platzen. Mal läßt er Großväter ihren Enkeln erzählen, was geschieht, mal legt er die Ereignisse und ihre Deutung dem maoistischen Funktionär Lu Fang in den Mund. Ein Sinn, ein System, auch nur eine Konsequenz ist darin nicht zu erkennen.
Mag sein, daß manches, was dem westlichen Leser fremd oder einfach mißglückt erscheint, dem Chinesen vertraute Stilmuster sind. In diesem Fall hätte der Übersetzer gehörige Vermittlungsarbeit leisten müssen, im Text in einem Nachwort. Falls Su Tong doch ein großer chinesischer Autor sein sollte, hätte sein deutscher Verlag ihm einen schlechten Dienst erwiesen. Grotesker Höhepunkt dieser Nichtvermittlung ist ein Diagramm, auf dem der Erzähler die Namen der handelnden Personen so anordnet, daß sie einem weiblichen Geschlechtsteil ähneln. Nur stehen die Namen - friß, Leser, oder stirb! - in chinesischen Schriftzeichen da. MARTIN EBEL
Su Tong: "Die Opiumfamilie". Roman. Aus dem Chinesischen übersetzt von Peter Weber-Schäfer. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1998. 144 S., br., 32,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main