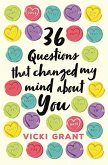So beginnt Andrew Millers neuer Roman: "Nach dem Massaker bei der Kirche von N. flog Clem Glass heim nach London." Aber weder kann der Fotoreporter das, was er in Afrika gesehen hat, vergessen, noch findet er sich in seinem früheren Leben zurecht. Er lässt sich treiben, trinkt zu viel, sucht Streit. Da meldet sich Clems Vater, der in einer klosterähnlichen Gemeinschaft lebt, und bittet ihn, sich um die unter schweren Depressionen leidende Schwester, eine Kunsthistorikerin, zu kümmern. Nach einem gemeinsamen Sommer auf dem Land erfährt Clem, dass sich der Anstifter des Massakers in Brüssel aufhalten soll.Knapp und eindringlich wird in Andrew Millers Roman von einem Mann erzählt, der das Grauen mit eigenen Augen gesehen hat und es dennoch schafft, seinem Leben neuen Sinn und Richtung zu geben.

Der Unverbesserliche: Andrew Miller mag's erbaulich
Ray sagt: "Die Menschen tun, was sie können. Ich finde, es hilft, sie sich besser vorzustellen, als sie tatsächlich sind." Ray ist natürlich naiv, vielleicht auch nur euphorisiert von seiner bevorstehenden Hochzeit, ein fröhlicher Don Quichotte, der wider alle Vernunft an eine bessere Zukunft glaubt und darum schon mal überall Zettelchen versteckt, die von Wunderheilungen, glücklichen Zufällen und ähnlich guten Nachrichten künden.
Die Familie Glass teilt diesen Optimismus nicht. Mutter Nora, eine resolute, prinzipienfeste Linke, war zwar die lebende historisch-politische Zuversicht; aber jetzt ist die Matriarchin tot, ihre Familie zerfallen. William, ihr Mann, hat sich in ein Männerkloster zurückgezogen. Tochter Clare hat den Kontakt zu ihm abgebrochen; die Kunsthistorikerin schreibt kluge Bücher über den Fauvismus und Géricaults "Floß der Medusa", die Ikone aller Schwarzseher, und leidet selbst an schweren Depressionen. Am schlimmsten hat es ihren Bruder getroffen: Seit Clem, der berühmte Fotoreporter, in Ruanda Augenzeuge eines Massakers an dreitausend Schulkindern wurde, lässt ihm das keine Ruhe mehr.
Aggressiv und arbeitsunfähig, flüchtet Clem sich in Alkohol, Sex und Selbstmitleid, schlägt im Namen der Gerechtigkeit einen pöbelnden Flugzeugpassagier zusammen und bezichtigt sich einer Vergewaltigung, die nie stattfand. Er will das Lamm sein, das alle Sünden der Welt auf sich nimmt, "Racheengel ohne Flügel und Schwert" und "Fotograf ohne Kamera", Hüter seiner kranken Schwester und Held der Zivilcourage. So viel Sühnearbeit überfordert den stärksten Mann.
Sein Kollege Frank gab Frau und Beruf auf und wandelte sich vom zynischen Kriegsreporter zum Samariter von Toronto. Eine ähnliche Umkehr schwebt auch Clem vor, als er mit Clare für einen Sommer aufs Land zieht, um im baufälligen Cottage von Freunden durch geschwisterliches Gärtnern, Einrichten, Kochen, Baden oder auch Vorlesen aus italienischen Reiseführern Seelenfrieden und Lebenssinn zurückzugewinnen. "Das reizvolle Einerlei der mit einfachen Arbeiten zugebrachten Tage", das Miller mit fast nachsommerlicher Schlichtheit, Demut und Detailtreue schildert, wirkt ein wenig ermüdend; bei Bruder und Schwester schlägt die Beschäftigungstherapie aber an. Sie finden in einfachen Handgriffen, Regeln und Ritualen Trost und Halt, und am Ende sind nicht nur Garten und Haus wieder bewohnbar und Vater und Tochter versöhnt - auch Clem ist auf dem Weg der Besserung. Der Schiffbrüchige der Medusa ist noch zu retten: Er verkauft seine Leica und beginnt, getragen "von einem bescheidenen, aber nützlichen Glauben an sich selbst, einem leisen, hartnäckigen Glauben an andere", zum ersten Mal zu weinen.
Miller geizt bei seiner Fotografentraumatherapie nicht mit schweren Dingsymbolen und Metaphern vom Hin- und Wegschauen. Das menschliche Auge ist, anders als das Objektiv, "keine Maschine. Es lebte, glitzerte im Gesicht, wurde von Tränen benetzt." Alle Glasses haben es daher, wie der Name schon sagt, an und mit den Augen. Clare, die professionelle Bilderdeuterin, fürchtet sich vor Dunkelheit; Mutter starb fast blind, Vater will die Welt nicht mehr sehen. Clem sieht erst klar, als er sich einmal die Brille des Täters aufsetzt. Vom altem Reporterfieber befallen, hat er den Schlächter von Ruanda in Brüssel aufgespürt. Aber er trifft keinen brutalen Kriegsverbrecher, sondern einen alten Mann, der Clems Selbstgerechtigkeit entwaffnet: "Haben Sie Kinder?" Laurenzie, eine junge Frau aus Ruanda, zeigt dem Reporter später schreckliche Fotos aus der Kolonialzeit und im Bett die vage Möglichkeit von Liebe. Fotografieren und Verstehen schließen einander nach Susan Sontag aus; aber ein schuldbewusster weißer Fotograf kann wohl eine wütende, alleinerziehende Mutter aus Afrika lieben.
Miller ist unverbesserlicher Optimist. In all seinen Romanen gehen die Menschen, wenn nicht gänzlich geheilt, so doch verwandelt aus Krankheit und Katastrophen hervor. In seinem Erstling, einer Art "Parfüm" für Mediziner, war es ein Wundarzt im achtzehnten Jahrhundert, der, gefühllos geboren, durch "Die Gabe des Schmerzes" zum Menschen wurde. In "Eine kleine Geschichte, die meist von der Liebe handelt" stellte sich Casanova 1763 in London nach einer herben erotischen Niederlage als Mensch und Mann in Frage: "Ändere dich oder stirb." In "Zehn oder fünfzehn der glücklichsten Momente des Lebens" konnten zuletzt zwei verkrachte Existenzen am Krankenbett ihrer Mutter Atemnot und Verkrampfungen lösen.
Menschen, die, mit welthistorischen Krisen und tiefen Selbstzweifeln konfrontiert, über ihren Schatten springen und zögernd ins Leben zurückkehren, sind in der englischen Literatur derzeit nicht gerade selten. Abers anders als etwa Ian McEwan in "Saturday" oder Tim Parks in "Stille" findet Miller keine überzeugenden Bilder und Worte für das Ineinandergreifen von Fern- und Nächstenliebe, politischen und privaten Traumata. Nicht, weil er das (von Fergal Keanes in "Season of Blood" dokumentierte) Massaker erst auf Wunsch seines Lektors mit ein paar Zeilen zu beschreiben versuchte: Die Verbindung zwischen dem Völkermord in Ruanda und der Sommerhaus-Kur in der englischen Provinz bleibt an der Oberfläche. Miller hat ein ernstes Thema, das ihn auch persönlich betraf (sein Bruder ist Fotoreporter), gewissenhaft, unaufgeregt und bedächtig umkreist. Aber er kommt dem heißen Kern nicht wirklich nahe und selten über therapeutische Erbauungsliteratur hinaus. Wer weiter leben und bei Trost bleiben will, muss einfach daran glauben, dass die Menschen im Grunde gut und gutgemeinte Romane nicht immer schlecht sind.
MARTIN HALTER
Andrew Miller: "Die Optimisten". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingl. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2007. 334 S., geb., 21,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Berührt zeigt sich Rezensent Jürgen Brocan von Andrew Millers Roman über einen Fotoreporter, der von einem Massaker in Afrika, das er als Augenzeuge miterlebte, völlig aus der Bahn geworfen wird und erst allmählich wieder auf die Beine kommt, als er sich um seine psychisch kranke Schwester kümmert. Er lobt Millers zurückhaltende, eher andeutende als beschreibende Erzählweise, die das Entscheidende nie direkt benenne, sondern nur in seinen Auswirkungen sichtbar mache. Fragen nach dem Umgang mit dem Grauen greift Miller seines Erachtens in "souveräner Beiläufigkeit" auf, ohne eindeutige, gar einfache Antworten zu geben. Bei der Auseinandersetzung des Fotoreportes mit der Banalität des Bösen, seiner eigenen konfliktreichen Familiengeschichte und dem Thema Schuld enthalte sich der Autor jeden Kommentars. Bemerkenswert scheint Brocan, wie der Roman auf einer Metaebene die Frage nach Möglichkeit einer adäquaten Darstellung des Grauens thematisiert. Sein Resümee: ein Roman, der trotz seiner "unbeantworteten Leerstellen" deutlich "Spuren nach der Lektüre" hinterlässt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH