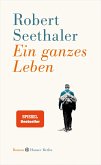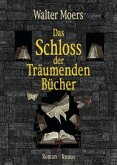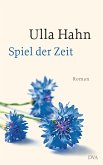Nasrija, Irak, 1989: Am Tag der letzten Abiturprüfung wird Mahdi zu einem Ausflug eingeladen. Sein Klassenkamerad Ali hat sich ein Auto ausgeliehen, und die beiden wollen das Ende der Schulzeit feiern. Doch es ist das falsche Auto, und Ali kennt die falschen Leute die beiden werden ohne Anklage und Prozess inhaftiert. Mahdi stehen zwei Jahre Gefängnisalltag bevor, Hunger, Folter, Grausamkeiten, Zynismus: Zum Geburtstag Saddam Husseins wird den Häftlingen eine Amnestie in Aussicht gestellt doch dann bekommt jeder nur eine Orange als Geschenk. Mahdi rettet sich in dieser Hölle durch seine Begabung zum Geschichtenerzählen. Drastisch, tragikomisch und ergreifend berichtet er Episoden aus seiner Kindheit und Jugend, besonders von der Freundschaft mit dem Taubenzüchter Sami und dem Geschichtslehrer und Literaturübersetzer Razaq. Der Roman lässt ein eindrucksvolles Bild des Irak der achtziger und neunziger Jahre entstehen. Nach seinem fulminanten, viel beachteten Debüt legt Abbas Khider hier seinen zweiten Roman vor.

Abbas Khider porträtiert die Ära Saddam Husseins
Von Wolfgang Günter Lerch
Auch im Islam gilt die Taube als ein Symbol für Liebe und Frieden. "Tauq al hamama", das Halsband der Taube, nannte der berühmte mittelalterliche Schriftsteller Ibn Hazm al Andalusi, den der Autor auch erwähnt, seine poetische Liebes- und Lebenslehre; und in arabischen Dörfern - etwa im Niltal oder in Mesopotamien, an den Ufern von Euphrat und Tigris - stechen dem Besucher überall die turmhohen Taubenschläge in die Augen.
In "Die Orangen des Präsidenten", seinem zweiten Roman, lässt Abbas Khider seinen Protagonisten Mahdi Hamama, der mit dem Taubenzüchter Sami befreundet ist und später auch ein wenig in diese Kunst eingewiesen wird, seine Lebensgeschichte erzählen. Es ist, zu großen Teilen, auch die Lebensgeschichte des Autors selbst. Der Iraker Abbas Khider, dessen Erstling "Der falsche Inder" als Geschichte einer Flucht aus der verwüsteten irakischen Heimat schon für Aufsehen sorgte, lebt heute in Berlin. Der 1973 in der irakischen Hauptstadt Bagdad geborene Schriftsteller verließ 1996 den Irak, wo er aus politischen Gründen verurteilt und zwei Jahre lang unter entwürdigenden Umständen inhaftiert war.
Ein ähnliches Schicksal erleidet sein Romanheld. Im Jahre 1989 - der Krieg zwischen dem Irak Saddam Husseins und der Islamischen Republik Iran unter Ajatollah Chomeini ist gerade ein Jahr vorüber - wird der Abiturient Mahdi kurz nach dem Ende seiner schriftlichen Prüfungen festgenommen, als er mit seinem Freund Ali eine Spritztour mit dem Auto unternimmt. Was man ihm vorwirft, weiß er nicht. Im Irak des Diktators Saddam Hussein, der von Samir al Khalil, alias Kanan Makkija, als "Republik der Angst" beschrieben worden ist, bedarf es auch keiner Beweise; es genügt, dass man "die falschen Leute" kennt: Religiöse, Kommunisten, Demokraten, Kurden und andere, die das Regime nur als Staatsfeinde wahrnimmt. Mitgliedschaft in einer solchen staatsfeindlichen Gruppierung, lautet der Vorwurf.
Zwei Jahre bleibt Mahdi Gefangener in Saddams Kerkern. Eigene Erfahrungen des Autors aus dem Gefängnis fließen in dieses knappe, doch präzise geschriebene Buch ein, dessen unprätentiöse Sprache auf den Leser einen Sog ausübt. Ohne zu moralisieren, gelingt es dem Autor, durch die nüchterne Schilderung der zwiespältigen Alltagswirklichkeit jenes Klima der Angst zu rekonstruieren, in dem damals all jene lebten, die nicht zu den wenigen Nutznießern des "Systems" gehörten.
Im Wechsel mit den Kapiteln über die Haft Mahdi Hamamas erzählt Khider anhand seines Helden die Geschichte einer schiitischen Jugend. Die Hamamas ziehen von Hilla-Babylon im zentralen Irak in den Süden des Landes, nach Nasrija, in ein Kerngebiet der Schiiten. Die Familie ist traditionell religiös, doch nicht übertrieben eifrig. Sie hat sogar Kontakte zu Christen, die in vielem (etwa was die westliche Kleidung der Frauen angeht) so ganz anders sind. Doch selbst in der Republik der Angst gibt es einen normalen Alltag; der beginnt bei den persönlichen Problemen, die man meistern muss, und reicht bis zu den religiösen Festen der Schiiten, die das Regime freilich mit Misstrauen beobachtet. Mahdis Vater fällt im Krieg mit Iran, als der Junge neun ist; die Mutter stirbt später an Krebs. Mahdi kommt bei einem Onkel unter. Bald schon beginnt der nächste Krieg, nachdem der Irak Kuweit besetzt und sich einverleibt hatte. Repression, Gefangenschaft, Kriege - dies ist der Lebenshintergrund vieler Iraker, denen Khider hier eine Stimme verleiht.
Im Gefängnis trifft Mahdi auf Mitgefangene, die eines Tages verschwunden sind, Opfer des Geheimdienstes, der sie zuvor gefoltert hat, wie auch ihn. Doch eines Tages keimt Hoffnung auf - und der Roman bekommt seinen Titel: Denn immer am Geburtstag des großen Führers Saddam Hussein wird eine Amnestie verfügt. Euphorie bricht aus im Gefängnis; der Beamte, der die Amnestie verkündet, erscheint tatsächlich. Höchste, fast ekstatische Erwartungen schießen unter den Malträtierten ins Kraut. Dann der Tiefschlag: Niemand wird freigelassen, es gibt keine Amnestie. Lediglich eine Orange erhält jeder Gefangene. Nichts könnte den menschenverachtenden Zynismus im Reiche Saddams besser illustrieren als dieses Ereignis. Nur die Macht der Phantasie und das Erzählen von Geschichten helfen Mahdi Hamama über das Gefangensein hinweg. Es ist das aus den Erzählungen von "Tausendundeiner Nacht" bekannte Motiv, das auch Scheherazade, die mit dem Tod bedrohte Gefangene des Königs, am Leben erhält.
Abbas Khider: "Die Orangen des Präsidenten". Roman.
Edition Nautilus, Hamburg 2011. 160 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Wie ein Schlag hat dieser Roman den Rezensenten Jens Jessen getroffen: Wenn der aus dem Irak nach Deutschland geflohene Abbas Khider von den Erniedrigungen erzählt, die sein jugendlicher Protagonist in den Gefängnissen des Saddam Husseins ausgesetzt war, dann wird Jessen klar: "Der Lagerroman ist keine historische Gattung", er ist immer noch aktuell und "der Roman der Moderne par excellence". Seinen Schrecken bezieht er nicht nur aus deutschen Konzentrationslagern und russischen Gulags, sondern auch aus den orientalischen Gefängnissen und Folterkellern. Für Khider ist es der Kokon aus menschlichen Erfahrungen und Beziehungen, der den Menschen davor schützt, seine Würde und Identität unter den brutalen Schlägen der Staatsmacht zu verlieren, wie Jessen beeindruckt schildert und betont, dass Khider dabei aber nichts idealisiere, die hier geschilderte Jugend sei durchaus überschattet von fragwürdigen Erlebnissen und Charakteren. Außerdem weiß der Rezensent sehr zu schätzen, dass Khider nah am Geschehen bleibt und dies in einer Sprache erzählt, deren Poesie aus ihrer Lakonie rührt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH