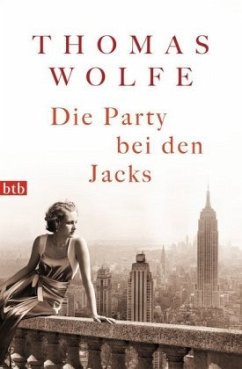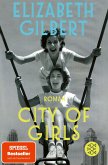Alles, was Rang und Namen hat, findet sich im Art déco-Ambiente von Esther und Frederick Jack ein: sie eine gefeierte Broadway-Künstlerin, er ein aus Koblenz stammender Jude und Selfmade-Millionär. Die Roaring Twenties sind auf ihrem Höhepunkt angelangt, schon wirft die Große Depression ihre Schatten voraus. Doch vom drohenden Ende der Sause will man bei den Jacks noch lange nichts wissen ... Mit seiner Innenansicht einer New Yorker Luxusadresse - von der Dachterrasse bis hinab in den Untergrund, von wo die Subway feine Vibrationen durchs Gebäude schickt - zeichnet Wolfe das Panoptikum einer faszinierenden Stadt und einer faszinierenden Epoche.

Ein Fund aus dem Nachlass von Thomas Wolfe: Eine Gruppe von New Yorkern feiert am Vorabend des Zusammenbruchs der Börse ein Fest, wie es die Stadt noch nicht gesehen hat.
Von Verena Lueken
Es ist eine bemerkenswerte Gesellschaft: Bankiers und Theaterleute, Kritiker, kühle Debütantinnen und alte Schabracken, Zyniker, Gute-Mine-Macher, Schlechte-Mine-Macher, Übersättigte, Gierige, Ehebrecher, vorübergehende Geliebte, Unterhaltungskünstler und eine Gastgeberin, die von sich selbst begeistert ist. Bald wird sie taub sein. Zur Party bei den Jacks kommen sie zusammen. Alles ist tadellos vorbereitet von den diebischen Dienstboten und einer Haushälterin, die trinkt. Die Räume von riesigen Dimensionen sind zurückhaltend und mit genau dem richtigen Maß an Lässigkeit dekoriert, im Kamin knistern die Holzscheite, und Mrs. Esther Jack, die auch Bühnenbilderin ist, hat es geschafft, dem Ganzen eine Art Einfachheit zu geben, die sich mit Geld nicht kaufen lässt.
Der Rest dann schon. Das Büfett strahlt voll Köstlichkeiten, die Silberplatten glänzen, die Braten sind perfekt gebräunt, der Kaviar schimmert, und über allem liegt der Duft der Gewürznelken, die den Schinken spicken. Es ist ein Festmahl ungeahnter Pracht und gleichzeitig lässiger Eleganz, wie es nicht viele hinbekommen. Die Attraktion des Abends soll ein Drahtpuppenspieler sein, der Hit der Saison, der in einem der Gästezimmer seine Koffer abgestellt und sich ein Kostüm angezogen hat, das ihn zum Zirkusdirektor macht.
Die Zeit: Frühjahr 1928. Der Ort: New York und dort eine Wohnung in einem imposanten Apartmenthaus an der Park Avenue. Wenn die Subway unter ihm her rattert, bebt noch im siebten Stock der Boden. Und der Hausherr, den wir in den ersten Kapiteln als Sohn eines jüdischen Privatbankiers in einer mittelalterlichen Stadt am Rhein kennengelernt haben, verliert für Augenblicke das Vertrauen in die "schillernde Blase der Spekulation", der er seinen Reichtum, seine fünfzig Angestellten und sein schiffsartiges Automobil verdankt.
Was wollen diese Leute, die sich an jenem Abend bei den Jacks treffen? Was verbindet sie, wenn sie etwas verbindet jenseits gesellschaftlicher Konvention? Mögen sie einander, interessieren sie sich füreinander, machen sie Geschäfte miteinander, freuen sie sich über ein Wiedersehen, schmeckt das Essen wenigstens? Es ist erstaunlich, wie lange Thomas Wolfe unsere Aufmerksamkeit mit der Beschreibung von Einrichtungs- und Dekorationsdetails, von körperlichen Merkmalen und kommunikativen Eigenheiten der Gäste unterhalten kann, ohne auf eine einzige dieser Fragen eine Antwort zu geben. Er hat eine Satire, eine Gesellschaftssatire geschrieben, in der - so sieht man es kommen - der Stil, der das ganze System stützt, mit diesem zusammenkrachen wird. Vorboten des Ruins erkennen allein die kleinen Leute, die Stenotypistin in der Bank, die Aufzugführer an der Park Avenue, die Feuerwehrleute, die dort in der Küche mit den Zimmermädchen schäkern. Am Ende steht das Haus in Flammen, die Gäste haben sich auf die Straße gerettet, und auch wenn sie schließlich in die Wohnung der Jacks zurückkehren können, um bei einem letzten Drink dieses ungeahnte Erlebnis des Brandes, mit dem die Party endete, noch einmal Revue passieren zu lassen, wissen wir doch: Es wird nie wieder sein wie an diesem Abend, bevor der Fahrstuhl Feuer fing.
Thomas Wolfe, geboren im Jahr 1900 und bereits 1938 gestorben, ist weltweit und in Deutschland allemal vor allem für seinen Debütroman "Schau heimwärts, Engel" berühmt, den er 1929 herausbrachte und der bis in die siebziger Jahre hinein in jedem Bücherschrank bildungsbürgerlicher Familien zu finden war, was vor allem den Jugendlichen im Haus zugute kam. Möglicherweise hatten die Eltern das Buch als Drama auf dem Theater gesehen und erinnerten sich. Aber nur die Jugendlichen hatten vermutlich die Geduld, die Sehnsucht nach Selbstbehauptung und das Verlangen nach Pathos, die das Lesen des riesigen Werks voraussetzt. "Of Time and the River", Wolfes zweiter Roman, war in Amerika einige Jahre später sein einziger Bestseller, und damals schrieben die Kritiker, Wolfe sei mit F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway und William Faulkner einer der wichtigsten amerikanischen Autoren der ersten Jahrhunderthälfte. Oder könnte es zumindest werden. Dann starb Wolfe an Tuberkulose, und einige Jahrzehnte später starb auch sein Ruf. "Leaver-outers" wie Fitzgerald trafen den Geschmack von Publikum und Kritik besser als "putter-inners" wie Wolfe, der sich selbst, wie wir im Nachwort lesen, in einem Brief an Fitzgerald so nannte.
Was also hat es mit "Die Party bei den Jacks" auf sich, der deutschen Erstausgabe eines Werks, dessen Original man erst seit 1995 in den Veröffentlichungslisten von Wolfes Büchern findet? Suzanne Strutman und John L. Idel haben es 1995 aus dem Nachlass gefischt, und dass dem Titel keine Gattungsbezeichnung folgt, lässt ahnen, worum es sich handelt: ein unvollendet gebliebenes Buch, eine Sammlung von Kapiteln, die über Jahre hinweg entstanden und die ihrer Überarbeitung harrten. So stehen die ersten beiden Kapitel, die am Rhein spielen und von der Kindheit Friedrich Jacks und den antisemitischen Anfeindungen seiner Klassenkameraden handeln, auch stilistisch ziemlich unverbunden vor den folgenden, in denen die Party vorbereitet und schließlich gefeiert wird. Und Wolfes Stilmittel der Wiederholung - wie oft lesen wir "furios", "selbstgewiss", "fiebrig"! - funktioniert nicht so, wie es wohl gemeint war, als Namenszusatz sozusagen, sondern wirkt ein wenig ungelenk, unfertig eben, und es wäre gut, der Leser wüsste, warum, bevor es ihm auffällt.
Dass Wolfe am besten war, wenn er beobachtete und aufschrieb, was er sah, das zeigt sich auch hier. Wie "zersplitternde Schäfte aus Stahl und Stein" ragen die Wolkenkratzer Manhattans in die Höhe. Nur eine Stadt wie diese kann einen Mann wie Jack wachsen lassen, den wir als angstvolles Kind kennenlernen und dann als einen erleben, dessen Leben dreißig Jahre lang "an Tempo immer mehr zugelegt" hatte. Das hat enorme Wucht und auch Komik. Ein Mann wie Mr. Jack bringt noch Verständnis auf für seinen brutalen, gierigen Chauffeur, dessen "verderbtes, vergiftetes, finsteres Gesicht über dem Lenkrad lauerte" und der seinerseits nur von dieser "furiosen Stadt" geschaffen worden sein konnte, "mit seinem dunklen talgigen Körper, in dem sich wie in Millionen anderer Männer, die graue Hüte trugen und Gesichter von derselben leblosen und unsäglichen Tönung hatten, die Grundsubstanz der Stadt verdichtet zu haben schien, aus dem Stoff des Gehweggraus, aber auch aus dem Stoff der Gebäude, Türme, Tunnel, Brücken, Straßen".
Das Nachwort von Kurt Dasow klärt uns über die autobiographischen Hintergründe des Romans - eine Affäre mit der Gattin eines liberalen Wallstreet-Spekulanten und eine Party in deren Haus im Jahr 1930, was das Kapitel "Der Geliebte" zu einer Art Selbstporträt macht, aus dem der Autor aber wieder entwischt - wie auch über die Realnamen einiger Figuren auf - etwa des Puppenspielers Piggy Logan, der Alexander Calder war. Dasow, wiewohl voller Bewunderung für Wolfe und hoffnungsvoll, eine Neubewertung seines Gesamtwerks stehe bevor, weist aber auch darauf hin, dass Wolfe selbst, der "Die Party bei den Jacks" für seine "am dichtesten verwobene Arbeit" hielt, eine weitreichende Überarbeitung des Manuskripts für notwendig hielt. Und so bleiben wir nach der Lektüre dieses nicht zum letzten Schliff gebrachten Buchs zurück mit der Frage, ob Wolfe, hätte er nur länger gelebt, möglicherweise tatsächlich einer der ganz Großen der amerikanischen Literatur geworden wäre.
Thomas Wolfe: "Die Party bei den Jacks".
Aus dem amerikanischen Englisch von Susanne Höbel. Nachwort von Kurt Darsow. Manesse Verlag, Zürich 2011. 350 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»1928 in New York, vor dem Börsencrash: Auf der Dachterrasse wird ordentlich gefeiert, unten zittern die Fundamente. Einer der besten Romane der Gatsby-Ära.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 03.07.2011
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ehrgeizig war das Unternehmen, das Thomas Wolfe mit diesem Roman einging. Ausdrücklich hat er sich an keinem Geringeren als Proust orientiert mit seiner Beschreibung des New Yorker Partylebens kurz vor dem Börsenkrach: die Jacks als Wolfes Verdurins. Als der Autor dann viel zu jung starb, blieb dieses Werk unvollendet zurück und wurde erst aus dem Nachlass 1995 veröffentlicht. Unfertig ist, was nun in deutscher Übersetzung vorliegt, zweifellos, wie Ulrich Rüdenauer feststellt. Aber "lesenswert" findet er es doch, wenngleich Proust dann doch noch einmal was anderes ist. Auch stilistisch: Im Vergleich mit dem "filigranen" Franzosen neigt Wolfe entschieden zum Überbordenden, der lieber ein Wort mehr als eins weniger hinschreibt. Dennoch ist, was er über die Atmosphäre der "Roaring Twenties" zu sagen hat, findet Rüdenauer, so aufschlussreich wie auch literarisch interessant.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Bissige Sozialstudie, feine Psychoanalyse des Ehebruchs, überbordende Schwelgerei, wenn es um Dekors und Delikatessen geht.«