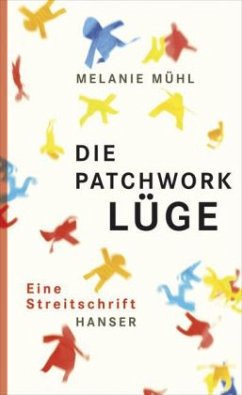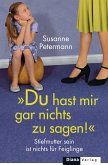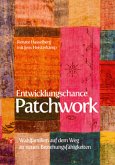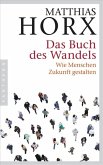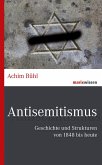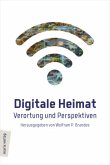Im ganzen Land findet man sie, in guten und weniger guten Kreisen, und niemand regt sich mehr über sie auf: Patchwork-Familien. Patchwork ist Flickwerk, das klingt nett und harmlos. Aber taugt es als Muster für unser Leben, unsere Gesellschaft und die Ehe? Melanie Mühl sieht in Patchwork-Familien das Resultat einer weit verbreiteten Lebenshaltung, die Festlegungen scheut. Doch können wir auf Verlässlichkeit so einfach verzichten? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der Vertrauen regelmäßig enttäuscht wird? Ein unzeitgemäßes Buch, das eine längst fällige Debatte auslösen wird.

F.A.Z.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Viel Diskussionsstoff findet Johan Schloemann in Melanie Mühls Streitschrift "Die Patchwork-Lüge". Deren Kritik an Schönfärberei von Trennungen und Scheidungen als Standardlösung für Enttäuschte sowie an der Idealisierung von Patchwork-Familien kann er durchaus etwas abgewinnen. In vielen Punkten kann er der Autorin zustimmen. Das Buch zeichnet sich für ihn auch dadurch aus, dass es sich keinen Gegner auf der Meta-Ebene wie den "Feminismus" oder die "Achtundsechziger" aussucht, sondern die Bindungsunfähigen "direkt moralisch" angeht. Im Blick auf Mühls Ausführungen der hohen Zahl von Trennungen allerdings bedarf es nach Ansicht von Schloemann genauerer Analysen als der von der Autorin "mit gutem Willen zusammengerührte Kulturkritik".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH