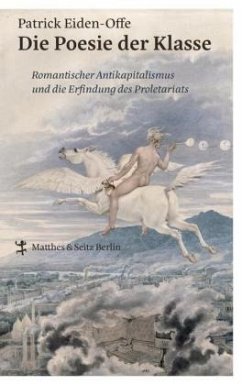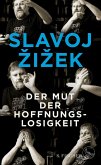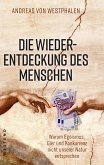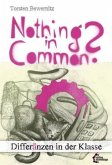Mit der Durchsetzung des Kapitalismus und der Industrialisierung entsteht im frühen 19. Jahrhundert aus verarmten Handwerkern, städtischem Pöbel, umherziehenden ländlichen Unterschichten, bankrotten Adligen und nicht zuletzt freigesetzten prekären Intellektuellen jenes neue soziale Kollektiv, das man in der Sprache der Zeit bald das Proletariat nennen wird. Allerdings existierte dieses zunächst noch nicht als formierte, homogene Klasse mit angeschlossenen politischen Parteien, die den Weg in die bessere Zukunft vorgeben. Die buntscheckige Erscheinung, die Träume und Sehnsüchte dieser allen ständischen Sicherheiten entrissenen Gestalten fanden neue Formen des Erzählens in romantischen Novellen, Reportagen, sozialstatistischen Untersuchungen, Monatsbulletins. Doch schon bald wurden sie - ungeordnet, gewaltvoll, nostalgisch, irrlichternd und utopisch, wie sie waren - von den Vordenkern der Arbeiterbewegung als reaktionär und anarchisch verunglimpft, weil sie nicht in die große lineare Fortschrittsvision passen wollten. In seiner bahnbrechenden Studie verhilft Patrick Eiden-Offe dem lange verdrängten romantischen Antikapitalismus zu seinem Recht und befreit die Sozial- und Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts aus ihren eindimensionalen Sichtachsen. Dabei wird nicht zuletzt deutlich, dass die historische, poetisch besungene unordentliche Klasse den heutigen Figuren von Prekarität nach dem Ende der alten Arbeitsgesellschaft verblüffend ähnlich ist.

Handwerkerkommunisten auf Wanderschaft: Patrick Eiden-Offe begeistert sich für die Frühgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Hermann Hesses Satz gilt gerade auch für geistige und soziale Bewegungen. Man denke an das Urchristentum im Vergleich zur etablierten Staatsreligion: Das Ursprüngliche wirkt im Rückblick wildwüchsiger, lebendiger, bunter, es verströmt die Poesie des jugendlichen Aufbruchs gegenüber der späteren Prosa der eingefahrenen Verhältnisse.
Nach diesem suggestiven Modell präsentiert der Berliner Kulturwissenschaftler Patrick Eiden-Offe eine neue Lesart der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Gestützt auf die Autorität von Marx und Engels, war man sich unter Linken ja lange einig, dass die sozialistische Theoriebildung der 1840er Jahre ein Prozess der Reifung war, in dem viel Kindliches, Versponnenes, Rückwärtsgewandtes ausgeschieden wurde. Die Frucht dieses Reifwerdens war demnach im Jahre 1848 "Das kommunistische Manifest".
Es proklamierte die Bildung einer neuen Klasse, des "Proletariats", die mit dem entsprechenden Klassenbewusstsein auszustatten sei, um das Werk des weltgeschichtlichen Fortschritts hin zu universeller Freiheit und Gleichheit zu vollenden. Für Marx und Engels war ihr "materialistisch-kritischer Sozialismus" dank seiner wissenschaftlichen Fundierung dem Utopismus der französischen und britischen Frühsozialisten wie dem religiös eingefärbten Humanismus der deutschen Radikalen weit überlegen. Die Trennung von frühen Mitstreitern wie Wilhelm Weitling und Moses Hess erschien so als Reinigung der Theorie von rückständigen Elementen im Blick auf die Formung einer Partei des Proletariats, die programmatisch gefestigt den Weg in die Zukunft weisen sollte.
Indem Marx' Geschichtsphilosophie die Entfesselung der Produktivkräfte zur Bedingung des Übergangs zur freien Gesellschaft machte, verkoppelte sie, wie Eiden-Offe plausibel macht, die arbeitende Unterschicht des frühen neunzehnten Jahrhunderts zwanghaft mit der Logik des technisch-ökonomischen "Fortschritts", der Durchsetzung der modernen Leistungsgesellschaft. Das Proletariat, das Marx konzipierte, definiert sich ausschließlich als Klasse der Arbeit: jetzt noch dazu verdammt, seine werktätige Kraft billig verkaufen zu müssen, bald aber in gut organisierten Arbeitskämpfen erste Terraingewinne verbuchend und langfristig stark genug, die Macht über die Produktionsmittel an sich zu reißen.
Die Revolution blieb bekanntlich aus. Stattdessen kam es in der zweiten Jahrhunderthälfte zu einer immer geschmeidigeren Integration der sozialdemokratisch geführten Arbeiterschaft in Deutschlands Aufstieg zur führenden Industrienation, die erstmals auch Wohlstandssteigerungen für die breite Masse abwarf. Eiden-Offe bezeichnet dies als Prozess der "Uniformierung" und "nationalen Hegung" der deutschen Arbeiterschaft. Man könnte auch von einem neuen Schub der Sozialdisziplinierung sprechen, der darin kulminierte, dass Deutschlands Proletarier die bürgerliche Arbeitsmoral nun ebenfalls vollständig verinnerlichten. Gegen die "Vergottung der Arbeit" gerade in der Ersten Internationale und der deutschen Sozialdemokratie begehrte dann Marx' Schwiegersohn Paul Lafargue mit seinem Essay "Das Recht auf Faulheit" (1880) auf. Es nutzte nichts.
Dagegen die Anfänge! "Poesie der Klasse" - das ist für Eiden-Offe die faszinierend buntscheckige Gestalt des in den 1840er Jahren eigentlich noch gar nicht existenten, sich aus sehr verschiedenen Unterschichtsgruppen erst langsam herausbildenden Proletariats. Und es ist die Buntscheckigkeit der Widerstandsformen und -phantasien, die diese Opfer der brutalen ersten Phase der Industrialisierung entwickelten. Orientiert an E. P. Thompson und Eric Hobsbawm, den Koryphäen der britischen "Geschichte von unten", erinnert Eiden-Offe an das Sozialrebellentum der Maschinenstürmer, der brandschatzenden Landarbeiter, aber auch jener frühen Moderne-Aussteiger, die sich auf traditionelle Lebensformen beriefen und beispielsweise das unzeitgemäße Wandern der Handwerksgesellen der Ankettung an den Fabrikarbeitsplatz vorzogen.
In diesem Kontext kommt es zu einer Ehrenrettung von Wilhelm Weitling, dem ersten Kommunisten Deutschlands. Aus der Sicht von Marx und Engels war die Lehre des Schneidergesellen Weitling mit ihrer Beschwörung von Handwerkerbräuchen und -festen als Quelle gesellschaftlicher Solidarisierung ein Rückfall in reaktionäres Denken. Eiden-Offe erblickt darin ein Bildungsprogramm, das verwandt ist mit dem romantischen Projekt der "Neuen Mythologie": Das einfache Volk braucht verbindende Mythen und Rituale, die seine Vor-Denker (beziehungsweise Vor-Dichter) ihm durch eine Neuerfindung von alten Erzählungen und Vergemeinschaftungspraktiken zur Verfügung stellen sollen. So ergibt sich eine verblüffende Nähe von Weitlings Handwerkerkommunismus zu Ludwig Tiecks Novelle "Der junge Tischlermeister", die ebenfalls vor den Fliehkräften einer Moderne warnt, welche die alten Solidarverbände zerstört und nichts Gleichwertiges an ihre Stelle zu setzen vermag.
Weitlings und Tiecks Texte sind für Eiden-Offe auch "Poesie der Klasse" im Sinn eines Genitivus subjectivus: Schriften, die die imaginäre Welt der Arbeiter prägen, ihre Leiden, Ängste und Hoffnungen artikulieren. Hier wird der Begriff indes überstrapaziert: "Die Klasse" schrieb ja nicht. Weitling war der einzige Nichtintellektuelle unter den von Eiden-Offe behandelten Vormärz-Autoren, die anderen - Georg Büchner, Georg Weerth, Ernst Willkomm, Ernst Dronke, Louise Otto-Peters - waren Kinder des Bürgertums, und sie schrieben, selbst wenn sie wie Büchner und Weerth die Armen ansprechen wollten, de facto für ein bürgerliches Publikum. In Bezug auf Willkomm, Dronke und Otto-Peters fällt es zudem schwer, von "Poesie" zu reden. Ernst Willkomm zum Beispiel gilt als Pionier des "sozialen Romans"; er ist tatsächlich der erste deutsche Autor, der breit das zeitgenössische Spektrum von Pauperismus, Entwurzelung der Landbevölkerung und Ausbeutung der Fabrikarbeiter (speziell der Frauen und Kinder) dargestellt hat. Aber sein Roman "Weisse Sclaven" von 1845, dem Eiden-Offe viel Platz widmet, ist heute zu Recht vergessen; gutgemeinte Literatur gewiss, poetisch aber ungenießbar.
Die Hartnäckigkeit, mit der Eiden-Offe hier versucht, trivialsten Passagen irgendeine tiefere Bedeutung abzupressen, erinnert merkwürdig an die linke Literaturwissenschaft der siebziger Jahre, die allemal der Gesinnungstüchtigkeit den Vorrang vor der Form gab. Die Romane von Willkomm, Dronke und Otto-Peters interessieren nur mehr als historische Dokumente, freiwillig lesen werden Nichtgermanisten sie kaum. Heines Weberlied, das berühmteste und schlagkräftigste Beispiel für gelungene Poesie der Klasse, erwähnt Eiden-Offe hingegen nur beiläufig. Man hat den Eindruck, dass für ihn die Klassiker auszuschließen sind, wo es um die Poesie der Klasse geht.
Der Name Goethe kommt in dem ganzen Buch nicht ein einziges Mal vor. Dabei hatte der in den ersten Jahren des Vormärz das poetische Werk vorgelegt, das die hellsichtigste Abrechnung mit dem modernen Kapitalismus und seinem globalen Expansionsdrang enthält: "Faust II". Das hat nur bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein niemand gemerkt.
MANFRED KOCH
Patrick Eiden-Offe: "Die Poesie der Klasse". Romantischer Antikapitalismus und die Erfindung des Proletariats.
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2017.
460 S., geb., 30,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Eiden-Offes literaturhistorische Studie "Poesie der Klasse" bietet ein fundiertes und ausführliches Konglomerat romantischer Kapitalismuskritik und ihrer literarischen Artikulation." - Kevin-Rick Doß, socialnet Kevin-Rick Doß socialnet 20180307