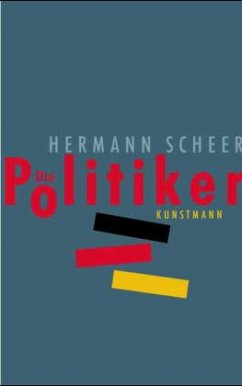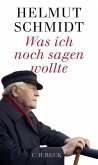Politik, im richtigen Sinne des Begriffs, ist gesellschaftliche Existenzbedingung. Ohne Politiker keine Politik. Es ist ein Alarmsignal für Gesellschaften, wenn Politik zum Unwort geworden ist und Politiker zum Schimpfwort. Die Erfahrung oder zumindest Wahrnehmung, dass das gesellschaftliche Mandat der "Politik" von den "Politikern" nicht mehr konstruktiv praktiziert wird, hat zu einem dramatischen Vertrauensverlust in beide geführt. Wenn sich soziale und wirtschaftliche Existenzgefahren zuspitzen und Wähler den gewählten Volksvertretern und Parteien deren Lösung nicht mehr zutrauen, droht ein Verfall demokratischer Verfassungsstaaten. Hermann Scheer, aktiver Politiker, Wissenschaftler und "praktischer Visionär" (Bundespräsident Rau), untersucht in diesem Buch die Grundbedingungen politischen Handelns, die derzeitige Verfassung unserer politischen Institutionen und ihrer Akteure - und die Vorstellungen, die wir uns von ihnen machen.
literaturtest.de
Die Reputation ist im Keller
Das Ansehen der Politiker in der Gesellschaft könnte schlechter kaum sein. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach (2001) rangierten sie weit hinter Ärzten, Pfarrern, Hochschulprofessoren, Unternehmern, Rechtsanwälten und sogar Journalisten am unteren Ende der Skala. Ähnlich gering ist das Vertrauen in den Politiker-Beruf in Großbritannien, in Italien und in Frankreich. Warum das so ist, hat ein Mann untersucht, der seit 1980 Mitglied des Bundestages ist und als überzeugter Streiter für erneuerbare Energien 1999 den Alternativen Nobelpreis erhielt.
Die Ängste der Wähler
Meist haben sie mehr versprochen, als sie selbst beim besten Willen einhalten können, lautet eine Erkenntnis Hermann Scheers. Zudem sorgen Existenz- und Lebensangst gerade in hoch entwickelten Staaten wie Deutschland, England, Frankreich und den Niederlanden für zusätzliches Misstrauen in die Regierenden. Politiker erscheinen als bevorzugte Projektionsfläche für die Nöte der Bürger. Die Arbeitslosigkeit wächst, staatliche Finanzkrisen sind eine Dauererscheinung, soziale Sicherungssysteme werden abgebaut, Reformen kommen nicht entscheidend voran. Dass die Politik diese Existenzprobleme allein nicht lösen, sondern nur die Rahmenbedingungen für Verbesserungen schaffen kann, ahnen oder wissen auch die meisten Bürger. Dennoch bestrafen sie bei der nächsten Wahl erst einmal die gerade Herrschenden.
Autonomie statt Unterwerfung
Politiker in einer Demokratie spiegeln stets, so schlussfolgert der Autor, den politischen Kulturzustand der Gesellschaft wider. Unkonventionelles, nicht konformistisches, nicht lineares politisches Denken müsse daher neu belebt werden. Und je mehr Bürger sich dafür die Freiheit nehmen, desto mehr belebe sich auch eine politische Zivilgesellschaft. Der Einzelne könne Politik aber auch anders praktizieren: mit eigenen Ideen und Initiativen, mit geistiger Autonomie statt Unterwerfung.
(Mathias Voigt)
Die Reputation ist im Keller
Das Ansehen der Politiker in der Gesellschaft könnte schlechter kaum sein. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach (2001) rangierten sie weit hinter Ärzten, Pfarrern, Hochschulprofessoren, Unternehmern, Rechtsanwälten und sogar Journalisten am unteren Ende der Skala. Ähnlich gering ist das Vertrauen in den Politiker-Beruf in Großbritannien, in Italien und in Frankreich. Warum das so ist, hat ein Mann untersucht, der seit 1980 Mitglied des Bundestages ist und als überzeugter Streiter für erneuerbare Energien 1999 den Alternativen Nobelpreis erhielt.
Die Ängste der Wähler
Meist haben sie mehr versprochen, als sie selbst beim besten Willen einhalten können, lautet eine Erkenntnis Hermann Scheers. Zudem sorgen Existenz- und Lebensangst gerade in hoch entwickelten Staaten wie Deutschland, England, Frankreich und den Niederlanden für zusätzliches Misstrauen in die Regierenden. Politiker erscheinen als bevorzugte Projektionsfläche für die Nöte der Bürger. Die Arbeitslosigkeit wächst, staatliche Finanzkrisen sind eine Dauererscheinung, soziale Sicherungssysteme werden abgebaut, Reformen kommen nicht entscheidend voran. Dass die Politik diese Existenzprobleme allein nicht lösen, sondern nur die Rahmenbedingungen für Verbesserungen schaffen kann, ahnen oder wissen auch die meisten Bürger. Dennoch bestrafen sie bei der nächsten Wahl erst einmal die gerade Herrschenden.
Autonomie statt Unterwerfung
Politiker in einer Demokratie spiegeln stets, so schlussfolgert der Autor, den politischen Kulturzustand der Gesellschaft wider. Unkonventionelles, nicht konformistisches, nicht lineares politisches Denken müsse daher neu belebt werden. Und je mehr Bürger sich dafür die Freiheit nehmen, desto mehr belebe sich auch eine politische Zivilgesellschaft. Der Einzelne könne Politik aber auch anders praktizieren: mit eigenen Ideen und Initiativen, mit geistiger Autonomie statt Unterwerfung.
(Mathias Voigt)
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Die Politikerbeschimpfung, stellt Dieter Rulff eingangs seiner Besprechung fest, habe nun schon seit langem ihren "Stammplatz im Topoi der maulenden Mehrheit". Da sei es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit gewesen, dass einem Betroffenen einmal "der Kragen platzen" und er "zur Selbsthilfe" greifen würde. Dies habe der Bundestagsabgeordnete und Solarenergieexperte Hermann Scheer mit diesem Buch nun, lobt Rulff, "auf eine äußerst intelligente Weise" getan. Nur gehe es, schreibt Rulff, Scheer dabei eben einmal nicht um bloße Selbstbestätigung, "sondern um Veränderung". Dazu werden von Scheer dann nicht zuletzt strukturelle Probleme dargelegt - um zu zeigen, wo es wirklich auf Änderungen ankäme. Der Rezensent gibt vor allem folgende Überlegung Scheers wieder: Da sich kaum eine Berufsgruppe "periodisch solch existenziellen Ängsten ausgesetzt" sehe wie die meisten Politiker, die bei jeder Wahl um ihre Existenz bangen müssten, diene "ein Großteil der Parteiarbeit der Minderung dieser Angst" - zugleich bilde dies dann aber eben auch den Hauptgrund für die Bildung von Seilschaften und eine Übervorsicht im täglichen Handeln.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH