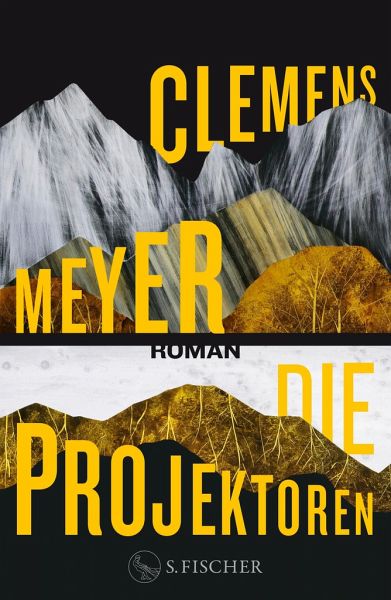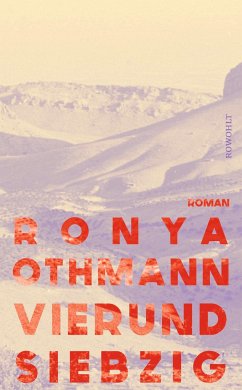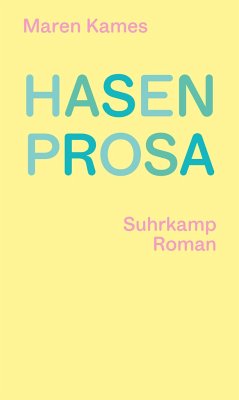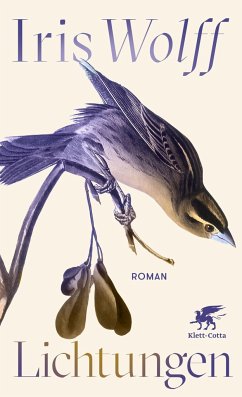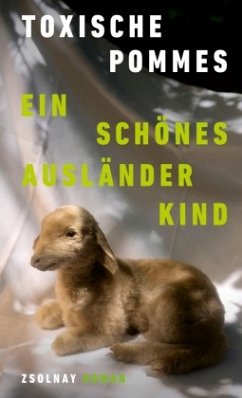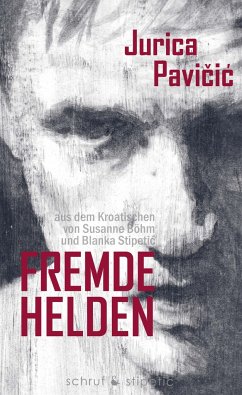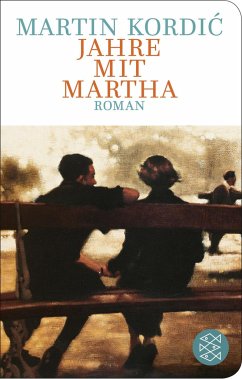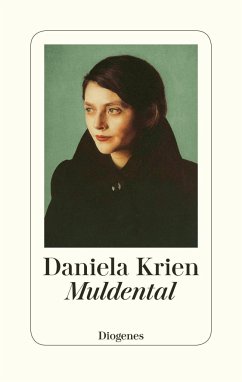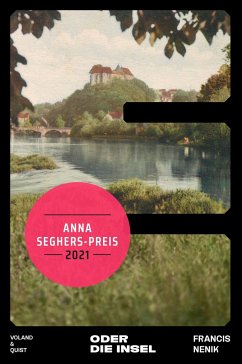Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Der neue Roman von Clemens Meyer: Ein Epos über die Krisen Europas und die Kunst des ErzählensVon Leipzig bis Belgrad, von der DDR bis zur Volksrepublik Jugoslawien, vom Leinwandspektakel bis zum Abenteuerroman. Schonungslos und rasant erzählt »Die Projektoren« von unserer an der Vergangenheit zerschellenden Gegenwart - und von unvergleichlichen Figuren: Im Velebit-Gebirge erlebt ein ehemaliger Partisan die abenteuerlichen Dreharbeiten der Winnetou-Filme. Jahrzehnte später finden an genau diesen Orten die brutalen Kämpfe der Jugoslawienkriege statt - mittendrin eine Gruppe junger Rechts...
Der neue Roman von Clemens Meyer: Ein Epos über die Krisen Europas und die Kunst des Erzählens
Von Leipzig bis Belgrad, von der DDR bis zur Volksrepublik Jugoslawien, vom Leinwandspektakel bis zum Abenteuerroman. Schonungslos und rasant erzählt »Die Projektoren« von unserer an der Vergangenheit zerschellenden Gegenwart - und von unvergleichlichen Figuren: Im Velebit-Gebirge erlebt ein ehemaliger Partisan die abenteuerlichen Dreharbeiten der Winnetou-Filme. Jahrzehnte später finden an genau diesen Orten die brutalen Kämpfe der Jugoslawienkriege statt - mittendrin eine Gruppe junger Rechtsradikaler aus Dortmund, die die Sinnlosigkeit ihrer Ideologie erleben muss. Und in Leipzig werden bei einer Konferenz in einer psychiatrischen Klinik die Texte eines ehemaligen Patienten diskutiert: Wie gelang es ihm, spurlos zu verschwinden? Konnte er die Zukunft voraussagen? Und was verbindet ihn mit dem Weltreisenden Dr. May, der einst ebenfalls Patient der Klinik war?
Von Leipzig bis Belgrad, von der DDR bis zur Volksrepublik Jugoslawien, vom Leinwandspektakel bis zum Abenteuerroman. Schonungslos und rasant erzählt »Die Projektoren« von unserer an der Vergangenheit zerschellenden Gegenwart - und von unvergleichlichen Figuren: Im Velebit-Gebirge erlebt ein ehemaliger Partisan die abenteuerlichen Dreharbeiten der Winnetou-Filme. Jahrzehnte später finden an genau diesen Orten die brutalen Kämpfe der Jugoslawienkriege statt - mittendrin eine Gruppe junger Rechtsradikaler aus Dortmund, die die Sinnlosigkeit ihrer Ideologie erleben muss. Und in Leipzig werden bei einer Konferenz in einer psychiatrischen Klinik die Texte eines ehemaligen Patienten diskutiert: Wie gelang es ihm, spurlos zu verschwinden? Konnte er die Zukunft voraussagen? Und was verbindet ihn mit dem Weltreisenden Dr. May, der einst ebenfalls Patient der Klinik war?
Clemens Meyer, geboren 1977 in Halle (Saale), lebt in Leipzig. 2006 erschien sein Debütroman 'Als wir träumten', es folgten 'Die Nacht, die Lichter. Stories' (2008), 'Gewalten. Ein Tagebuch' (2010), der Roman 'Im Stein' (2013), die Frankfurter Poetikvorlesungen 'Der Untergang der Äkschn GmbH' (2016) und die Erzählungen 'Die stillen Trabanten' (2017). Für sein Werk erhielt Clemens Meyer zahlreiche Preise, darunter den Preis der Leipziger Buchmesse. 'Im Stein' stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, wurde mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet. Sein Roman 'Die Projektoren' wurde mit dem Bayerischen Buchpreis 2024 und dem Preis der LiteraTour Nord 2025 ausgezeichnet und stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2024. Für sein Gesamtwerk erhält Clemens Meyer den Lessing-Preis 2025 des Freistaates Sachsen. Literaturpreise: Preis der LiteraTour Nord 2025 Lessing-Preis des Freistaates Sachsen 2025 Bayerischer Buchpreis 2024 Klopstock-Preis für neue Literatur 2020 Stadtschreiber von Bergen-Enkheim 2018/2019 Premio Salerno Libro d'Europa 2017 Finalist Premio Gregor von Rezzori 2017 Longlist Man Booker International Prize 2017 Mainzer Stadtschreiber 2016 Bremer Literaturpreis 2013 Shortlist Deutscher Buchpreis 2013 Stahl-Literaturpreis, 2010 TAGEWERK-Stipendium der Guntram und Irene Rinke-Stiftung, 2009 Preis der Leipziger Buchmesse 2008 Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg, 2007 Märkisches Stipendium für Literatur, 2007 Förderpreis zum Lessing-Preis des Freistaates Sachsen, 2007 Mara-Cassens-Preis, 2006 Rheingau-Literatur-Preis, 2006 Einladung zum Ingeborg Bachmann-Wettbewerb, 2006 Nominierung zum Preis der Leipziger Buchmesse, 2006 2. Platz MDR-Literaturwettbewerb, 2003 Literatur-Stipendium des Sächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, 2002 1. Platz MDR-Literaturwettbewerb, 2001
Produktdetails
- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 1056
- Erscheinungstermin: 28. August 2024
- Deutsch
- Abmessung: 226mm x 147mm x 53mm
- Gewicht: 1055g
- ISBN-13: 9783100022462
- ISBN-10: 3100022467
- Artikelnr.: 70379053
Herstellerkennzeichnung
FISCHER, S.
Hedderichstraße 114
60596 Frankfurt
produktsicherheit@fischerverlage.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Sätze, die "tiefdunkel funkeln" macht Rezensent Cornelius Pollmer in Clemens Meyers monumentalem Roman aus. Nach der Aufregung um Meyers Wutanfall auf der Buchmesse wird es Zeit, sich wieder dem Text selbst zuzuwenden, fordert der Kritiker, denn dieser verlangt zwar nach Zeit und Konzentration, stellt sodann aber schlicht eine "schwer beeindruckende erzählerische Leistung" dar. Mal "wahnhaft abfließend", mal beunruhigend, mal "brüllend komisch" ist diese Geschichte, deren Inhalt so schwer zusammenzufassen ist, schwärmt Pollmer. So viel lässt sich sagen, es geht um die zweite Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts, den Zerfall Jugoslawiens und Karl May. Einen der wenigen Fixpunkte bietet die Figur "Cowboy", die sich am Widerstand der Tito-Partisanen gegen Hitler beteiligt und später beim "Kostümfilm durchschlägt" und noch ganz viel mehr, dass der Rezensent gar nicht alles aufführen kann. Es gibt hier atemberaubende Beschleunigungen, Verschränkungen zwischen Vergangenheit und Zukunft, Traum und Realität, "apokalyptische Feuerwerke" und Sätze, die Pollmer "Nägelkauen" lassen - jedenfalls ganz großes Kino, findet der Kritiker.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Wenn die Welt sich so weiterdreht, [...], wird "Die Projektoren" zu den Romanen gehören, die lesende Menschen alle zehn Jahre erneut aus dem Regal nehmen, wie den "Zauberberg". Judith von Sternburg Frankfurter Rundschau 20240828
Rezensentin Stephanie von Oppen möchte Clemens Meyer für seinen neuen Roman am liebsten gleich den Deutschen Buchpreis verleihen. Meyer entwirft ein atemberaubendes Panorama, jubiliert sie. Das Buch ist zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Jetztzeit angesiedelt und spielt in diversen Ländern, vereinigt jede Menge Geschichten, Tonarten und Schreibformen. Über allem schwebt, heißt es weiter, der Western, als eine Art Grundmetapher, aber auch als Stimmung, die zum Beispiel "Cowboy" anhaftet, der eine Hauptfigur des Buches zu sein scheint, ein Tito-Partisan, der später in DDR-Indianerfilmen mitspielt und noch später im IS-Irak landet. Nazis mischen auch mit, fährt Oppen fort, wobei selbst die von Meyer mit Empathie bedacht werden, wie das Buch laut Rezensentin überhaupt von psychologischem Tiefsinn geprägt, außerdem teils ausgesprochen lustig und, eben, durch und durch preiswürdig ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Großes Werk, das mich nicht fesselt
Wenn ein Buch zum Ziegelstein wird, dann muss jede Seite fesseln. Clemens Meyer lässt aber keine Umweg aus, so dass ich bis heute nicht weiß, worum es eigentlich geht.
Nazis auf dem Balkan scheint ein Thema zu sein. Dazu der schöne Witz …
Mehr
Großes Werk, das mich nicht fesselt
Wenn ein Buch zum Ziegelstein wird, dann muss jede Seite fesseln. Clemens Meyer lässt aber keine Umweg aus, so dass ich bis heute nicht weiß, worum es eigentlich geht.
Nazis auf dem Balkan scheint ein Thema zu sein. Dazu der schöne Witz auf S.53: „Hitler besucht eine Irrenanstalt, schreitet die Reihe der Insassen ab. Jeder Patient schreit: ‚Heil Hitler!‘ Nur am Ende der Reihe steht einer ganz still. Hitler: ‚Warum grüßen Sie nicht?‘ Der Mann: ‚Ich bin der Wärter, ich bin nicht verrückt.‘“
Ein anders Thema ist wohl die Verfilmung von Winnetou. Dafür gibt es unendliche genaue geografische Bezeichnungen.
Nach 164 Seiten habe ich die Segel gestreckt. Ich hoffe, die Weihnachtszeit bringt mir bessere Literatur. Für abgebrochene Bücher: nur 1 Stern
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Masse und Komplexität als Manko
Der mit einigem Abstand ‹gewichtigste›, für den diesjährigen Deutschen Buchpreis nominierte Roman ist «Die Projektoren» von Clemens Meyer, acht Jahre habe er daran gearbeitet, lies er verlauten. Dass Masse nicht vor Klasse …
Mehr
Masse und Komplexität als Manko
Der mit einigem Abstand ‹gewichtigste›, für den diesjährigen Deutschen Buchpreis nominierte Roman ist «Die Projektoren» von Clemens Meyer, acht Jahre habe er daran gearbeitet, lies er verlauten. Dass Masse nicht vor Klasse steht konstatierten die Juroren überdeutlich, indem sie Martina Hefters vergleichsweise «schmalbrüstigen» Roman gegenüber den 1041 Seiten von Meyers Epos literarisch höher bewertet und folglich auch mit dem Preis bedacht haben. Was dann zum Eklat bei der feierlichen Preisverleihung im Frankfurter Römer führte, wo Meyer lautstark den Preis für sich reklamierte, eine höchst peinliche Szene von Unbescheidenheit, die bei ihm aber nicht ganz ungewöhnlich ist. Schade, denn die Feuilletons sind sich im Lob einig wie selten. Man konnte lesen, dass der Roman «Die Projektoren» das Zeug zum Klassiker habe, ja sogar eine Wegmarke der deutschen Literatur dieses Jahrzehnts darstelle. Ist er darin gar dem «Zauberberg» vergleichbar, wie ein Kritiker euphorisch geschrieben hat?
Der Roman umfasst die Zeit vom Zweiten Weltkrieg bis in die Jetztzeit hinein. Örtlich ist er im Balkan angesiedelt, in Novi Sad im damaligen Jugoslawien, in dessen Kino sich die titelgebenden Projektoren befinden, die erzählerisch wiederum zu den dort gezeigten Filmen und deren Darstellern hinleiten. Die Eingangs-Szene bildet ein Gespräch in einer Leipziger Irrenanstalt, an dem ein Patient namens Dr. May beteiligt ist, dessen Romane und Verfilmungen wiederum auf die deutsch-jugoslawischen Western verweisen, die an dortigen Schauplätzen gedreht wurden, Winnetou lässt grüßen! Dazu passt denn auch, dass sich der Haupt-Erzählstrang um die Figur eines immer nur «Cowboy» genannten, ehemaligen Partisanen dreht, der den Widerstands-Truppen des späteren Präsidenten Josip Broz Tito angehört hat. Zusammenfassend geht es in diesem ungewöhnlich vielschichtigen Roman um das Thema Gewalt, um deren Kontinuität vor allem. Erkennbar ist dies auch in Ostdeutschland, wo sie mit dem beängstigenden Erstarken der politischen Rechten eine Rolle spielt, und brutaler noch auch im Irak zur Zeit des Islamischen Staates.
Alles greift ineinander in diesem ungewöhnlichen, immer für Überraschungen sorgenden Roman, der alle Dimensionen des Schreibens zu sprengen scheint. Zeiten und Orte überlappen sich ständig, Figuren tauchen unerwartet wieder auf, sorgen für neue Impulse in dem turbulenten Plot und verschwinden dann ebenso unerwartet wieder, geben Raum für neue Akteure. Das Figuren-Ensemble des Autors besteht zum Teil aus sehr skurrilen Typen wie den geistig zurück gebliebenen Schäfer, bei dem der Cowboy sich ungefragt einquartiert. In seiner Komplexität übertrifft dieser Roman so ziemlich alles, was derzeit im Fokus des lesenden Publikums steht. Und er überfordert es unübersehbar, Gesetze von Zeit und Raum außer Kraft setzend, vor allem aber in seiner immer wieder verblüffenden Rätselhaftigkeit.
«Die Projektoren» ist ein herausfordernd erzähltes, fast grenzenloses Epos voller Sprachgewalt, voller Lust am Fabulieren, narrativ unbekümmert hin und her springend, aber virtuos auch wieder aneinander anknüpfend. Sehr beeindruckend ist natürlich der Recherchefleiß des Autors, der noch in den kleinsten Verästelungen seines Plots mit vielen Details aufwartet und dadurch sehr bereichernd wirkt. Entspannt zu lesende Lektüre kann man angesichts der Themenfülle und der akribischen Detailverliebtheit des Autors natürlich nicht erwarten, man muss sich geduldig einlassen auf dieses Epos, in dem häufig auch psychologische Aspekte behandelt werden. Sprachlich originär, oft leichtfüßig, ebenso oft amüsant, zuweilen ins Irreale abgleitend, ist dies ein unbeirrt eigenwilliger Text eines großen Erzählertalents. Mit der schieren Textmasse und deren Komplexität hat sich Clemens Meyer allerdings selbst ein Bein gestellt, was sich nicht nur im Urteil der Buchpreisjury niedergeschlagen hat, sondern durchaus erwartbar auch im geringen Interesse und den auffallend vielen negativen Kommentaren des Lesepublikums!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Eine Hommage an die ehemalige Filmindustrie in osteuropäischen Kriegsgebieten
Das in zwei Segmente unterteilte Cover zeigt im Schriftbild Perspektiven, farblich vor dem mehrschichtigen Hintergrund gut platziert – kreativ.
Mit 1056 Seiten ist dieser Roman sehr umfangreich. Beginnend in …
Mehr
Eine Hommage an die ehemalige Filmindustrie in osteuropäischen Kriegsgebieten
Das in zwei Segmente unterteilte Cover zeigt im Schriftbild Perspektiven, farblich vor dem mehrschichtigen Hintergrund gut platziert – kreativ.
Mit 1056 Seiten ist dieser Roman sehr umfangreich. Beginnend in Annaberg-Buch im Erzgebirge geht die Zeitreise ins heutige Kroatien, nach Serbien etc., in Orte wie Novi Sad, Split, Belgrad oder ins Velebitgebirge. Stets spielen Projektoren, Filmvorführgeräte in Bioskopen, den Kinos vergangener Zeiten, eine wichtige Rolle neben der historischen Rückbesinnung auf endlose, verwirrende Kampfhandlungen der Partisanen zwischen deutschen, serbischen, kroatischen, russischen Soldaten etc. Auch auf die Helden der Projektoren wird Bezug genommen: Tarzan, Winnetou oder Old Shatterhand neben vielen Stummfilmkomikern. Auf den Autor Karl May, sein Leben und seine Erzählungen wird häufig zurückgegriffen. Wie das Leben eines jungen Meldegängers, Cowboy, in diesen Breiten durch den 2. Weltkrieg ausgesehen hat, wird mittels vieler Albträume bruchstückhaft unsortiert beschrieben. Der Inhalt folgt leider keiner linearen Abfolge, keinem roten Faden. Der Schreibstil, durchsetzt mit kroatischen Begriffen, teils mit langer Satzkonstruktion, ist anstrengend, auch stellenweise wirr. Man braucht robustes Durchhaltevermögen beim Lesen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Die Projektoren
Ein gewaltiges Werk von über eintausend beschriebenen Seiten präsentiert uns Clemens Meyer in seinem Roman 'Die Projektoren'. Es geht um den Krieg in Jugoslawien, um einen Partisanen, der sich später sein Geld als Komparse bei Indianerfilmen verdient. Wir begegnen …
Mehr
Die Projektoren
Ein gewaltiges Werk von über eintausend beschriebenen Seiten präsentiert uns Clemens Meyer in seinem Roman 'Die Projektoren'. Es geht um den Krieg in Jugoslawien, um einen Partisanen, der sich später sein Geld als Komparse bei Indianerfilmen verdient. Wir begegnen einem Neonazi, der in den kroatischen Bürgerkrieg zieht. Auch Dr. May aus der Leipziger Heil- und Pflegeanstalt wird thematisch behandelt.
Es ist ein Sammelsurium an Handlungsstränge, die sich zeitlich zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Heute bewegen, über Gewalt und Krieg berichtet und Historien mit Karl Mays Erfindungsreichtum paart.
Dieser Roman verlangt nach Ausdauer.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für